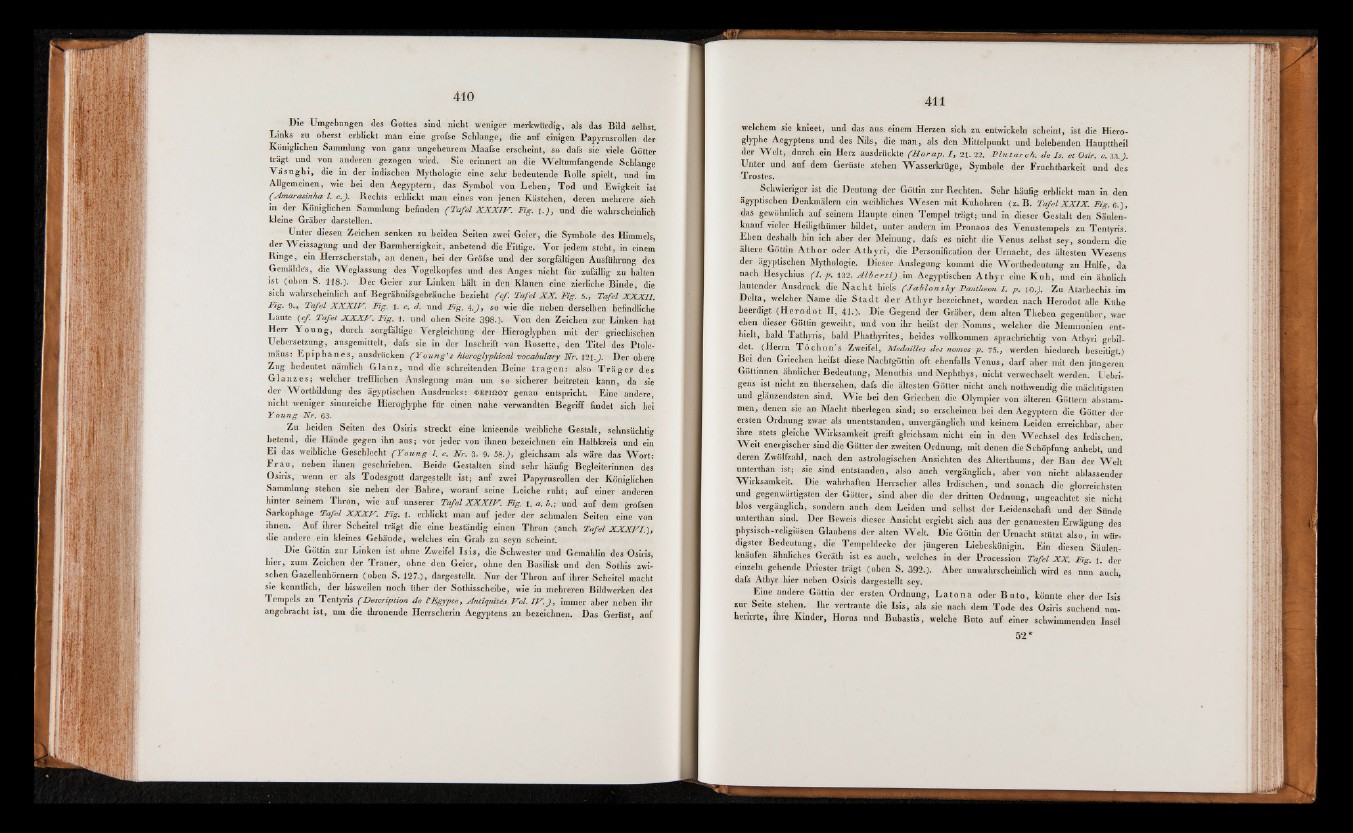
Die Umgebungen des Gottes sind nicht weniger merkwürdig, als das Bild selbst
Links zu oberst erblickt man eine grofse Schlange, die auf einigen Papyrusrollen der
Königlichen Sammlung von ganz ungeheurem Maafse erscheint, so dafs sie viele Götter
trägt und von anderen gezogen wird. Sie erinnert an die Weltumfangende Schlange
V ä su g h i, die in der indischen Mythologie eine sehr bedeutende Rolle spielt, und im
Allgemeinen, wie hei den Aegyptern, das Symbol von Lehen, Tod und Ewigkeit ist
(Amarasinha l. c.J. Rechts erblickt man eines von jenen Kästchen, deren mehrere sich
in der Königlichen Sammlung befinden (T a fe l X X X IV . Fig. U ) , und die wahrscheinlich
kleine Gräber darstellen.
Unter diesen Zeichen senken zu beiden Seiten zwei Geier, die Symbole des Himmels,
der Weissagung und der Barmherzigkeit, anbetend die Fittige. Vor jedem steht, in einem
Ringe, ein Herrscherstab, an denen, bei der Gröfse und der sorgfältigen Ausführung des
Gemäldes, die Weglassung des Vogelkopfes und des Auges nicht für zufällig zu halten
ist (oben S. 118.). Der Geier zur Linken hält m den Klauen eine zierliche Binde, die
sich wahrscheinlich auf Begrähnifsgehräuche bezieht (c f. T a fel X X . Fig. 5., T a fe l X X X I I .
Fig. 9-,. T a fe l X X X IV . Fig. \. c. d. und Fig. 4 .J , so wie die neben derselben befindliche
Laute (cf. T a fel X X X V . Fig. \. und oben Seite 398.). Von den Zeichen zur Linken hat
Herr Y o u n g , durch sorgfältige "Vergleichung der Hieroglyphen mit der griechischen
Uebersetzung, ausgemittelt, dafs sie in der Inschrift von Rosette, den Titel des Ptole-
mäns: E p ip h a n e s , ausdrücken ( Y o u n g ’’s hieroglyphical vocabulary Nr. 121.J; Der obere
Zug bedeutet nämlich Glanz, und die schreitenden Beine tra g e n : also T r ä g e r des
G la n z e s ; welcher trefflichen Auslegung man um so sicherer beitreten kann, da sie
der Wortbildung des ägyptischen Ausdrucks: OEPißor genau entspricht. Eine andere,
nicht weniger sinnreiche Hieroglyphe für einen nahe verwandten Begriff findet sich bei
Y o u n g Nr. 63.
Z u beiden Seiten des Osiris streckt eine knieende weibliche G estalt, sehnsüchtig
be ten d , die Hände gegen ihü au s ; vor jed er von ihnen bezeichnen ein Halbkreis und ein
E i das weibliche Geschlecht ( Y o u n g l. c. Nr. 3. 9. 58.J, gleichsam als wäre das W o r t :
F r a u , neben ihnen geschrieben. Beide Gestalten sind sehr häufig Begleiterinnen des
Osiris, wenn er als To d e sg o tt dargestellt is t; au f zwei Papyrusrollen der Königlichen
Sammlung stehen sie neben d e r B ah re , worauf seine Leiche ru h t; au f einer anderen
hinter seinem T h ro n , wie au f unserer T a fel X X X I V . Fig. l. a .b .] und au f dem grofsen
Sarkophage T a fel X X X V . Fig. l. erblickt man au f jeder der schmalen Seiten eine von
ihnen. A u f ihrer Scheitel trägt die eine beständig einen T h ro n (auch T a fe l X X X V I .) ,
die andere ein kleines Gebäude, welches ein Grab zu seyn scheint.
Die Göttin zur Linken is t ohne Zweifel I s i s , die Schwester u n d Gemahlin des Osiris,
h ie r, zum Zeichen d e r T ra u e r, ohne den Geie r, ohne den Basilisk u n d den Sothis zwischen
Gazellenhömem (oben S. 1270, dargestellt. Nur der T h ro n au f ih re r Scheitel macht
sie kenntlich, der bisweilen noch über der Sothisscheibe, wie in mehreren Bildwerken des
Tempels zu Tenlyris (Description de VEgypte, Antiquität Vol. IV . J , immer aber neben ihr
angebracht is t, um die thronende Herrscherin Aegyptens zu bezeichnen. Das Gerüst, auf
welchem sie k n ie et, u n d das aus einem Herzen sich zu entwickeln scheint, ist die Hieroglyphe
Aegyptens und des Nils, die man , als den Mittelpunkt u n d belebenden Haupttheil
der W e l t , durch ein Herz ausdrückte (H o r a p . I , 21. 22. P l u ta r c h . de Is. etOsir. c. 33J .
Un ter und au f dem Gerüste stehen W a ss e rk rü g e , Symbole der Fruchtbarkeit und des
Troste s.
Schwieriger ist die Deutung der Göttin zur Rechten. Seh r häufig erblickt man in den
ägyptischen Denkmälern ein weibliches W e s e n mit Kuhohren ( z .B . Ta fel X X IX . Fig. 6.) ,
das gewöhnlich au f seinem Haupte einen Tempel träg t; u n d in dieser Gestalt den Säulen-
knauf vieler Heiligthtimer bildet, un te r ändern im P ro n ao s des Yennstempels zu Tentyris.
Eh en deshalb bin ich aber der Meinung, dafs es nicht die Venus selbst sey, sondern die
ältere Göttin A t h o r oder A th y r i , die Personification der U rn ach t, des ältesten W e s e n s
der ägyptischen Mythologie. Dieser Auslegung kommt die W o rtb ed eu tu n g zn Hülfe, da
nach Hcsychius ( I . p. 132. A l b e r t i ) im Aegyptischen A th y r eine K u h , und ein ähnlich
lautender Ausdruck die N a c h t hiefs ( J a b l o n s k y Pantheon I . p. ) 0 Z u Atarbechis im
D e lta , welcher Name die S t a d t d e r A th y r bezeichnet, wurden nach Herodot alle Kühe
beerdigt (H e r o d o t H, 41.). Die Gegend der Gräber, dem alten T h eb en gegenüber, war
eben dieser Göttin geweiht, und von ih r heifst der Nomas, welcher die Memnonien enthielt,
bald Tathyris, bald Phathyrites, beides vollkommen sprachrichtig von Athyri gebildet.
-(Herrn T ö c h o n s Zweifel, Medailles des nomes p. 75., werden hiedurch beseitigt.)
B e i den Griechen heilst diese Nachtgöttin oft ebenfalls V en u s , d a rf aher mit den jüngeren
Göttinnen ähnlicher Bedeutung, Menuthis und Ncphthys, nicht verwechselt werden, ü eb ri-
gens is t nicht zu übersehen, dafs die ältesten Götter nicht auch nothwendig die mächtigsten
und glänzendsten sind. W i e bei den Griechen die Olympier von älteren Göttern abstammen
, denen sie an Macht überlegen sind; so erscheinen hei den Aegyptern die Götter der
ersten O rdnung zwar als unentstanden, unvergänglich u n d keinem Leiden erreichbar, aber
ihre stets gleiche W irk sam k e it greift gleichsam nicht ein in den W e c h s e l des Irdischen.
W e i t energischer sind die Götter der zweiten Ordnung, mit denen die Schöpfung anhebt, und
deren Zwölfzahl, nach den astrologischen Ansichten des Alterthums, der B a u der W e l t
unterthan ist; sie sind entstanden, also auch vergänglich, aber von nicht ablassender
Wirksamkeit. Die wahrhaften Herrscher alles Irdischen, u n d sonach die glorreichsten
u n d gegenwärtigsten der Götter, sind aber die der dritten Ordnung, ungeachtet sie nicht
blos vergänglich, sondern auch dem Le iden u n d selbst der Leidenschaft u n d der Sünde
unterthan sind. D e r Beweis dieser Ansicht ergicht sich aus der genauesten Erwägung des
physisch-religiösen Glaubens der alten W e lt. Die Göttin d e r Urnacht stützt a lso , in würdigster
Bedeutung, die Tempeldeckc der jüngeren Liebeskönigin. Ein diesen Säulenknäufen
ähnliches Geräth ist es au ch , welches in d e r Procession T a fe l X X . Fig. [ <)er
einzeln gehende Prieste r träg t (oben S. 392.). Aber unwahrscheinlich wird es nun auch,
dafs Athyr hier neben Osiris dargestcllt sey.
Eine andere Göttin der ersten O rd n u n g , L a t o n a oder B u t o , könnte eher der Isis
zur Seite stehen. Ih r vertrante die Isis, als sie nach dem T o d e des Osiris suchend rnn-
h en rrte , ihre Kin d er, Horns und Bu b astis, welche Buto au f einer schwimmenden Insel