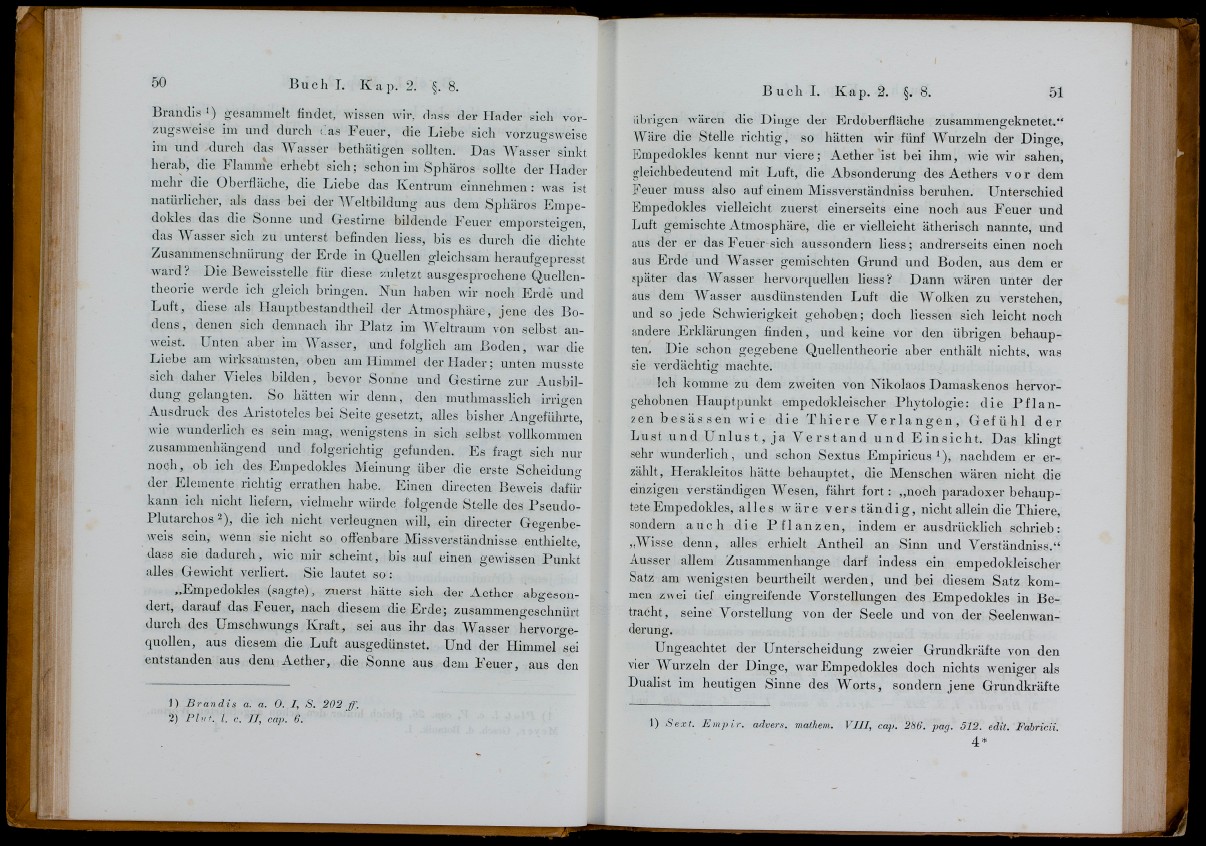
• illili;
. •7
•n
•
-1
i ì '
50 B u c h i . Kap. 2. §.8.
Brandls^) gesammelt findet, wissen wir, dass der Hader sich vorzugsweise
im und durch (:as Feuer, die Liebe sich vorzugsweise
im und durch das Wasser bethätigen sollten. Das Wasser sinkt
herab, die Flamme erhebt sich; schon im Sphäros sollte der Hader
mehr die Oberfläche, die Liebe das Kentrum einnehmen: was ist
natürlicher, als dass bei der Weltbildung aus dem Sphäros Empedokles
das die Sonne und Gestirne bildende Feuer emporsteigen,
das Wasser sich zu unterst befinden liess, bis es durch die dichte
Zusammenschnürung der Erde in Quellen gleichsam heraufgepresst
ward? Die Beweisstelle für diese i:uletzt ausgesprochene Quellentheorie
werde ich gleich bringen. Nun haben wir noch Erde und
Luft, diese als Hauptbestandtheii der Atmosphäre, jene des Bodens,
denen sich demnach ihr Platz im Weltraum von selbst anweist.
Unten aber im Wasser, und folglich am Boden, war die
Liebe am wirksamsten, oben am Himmel der Hader; unten musste
sich daher Vieles bilden, bevor Sonne und Gestirne zur Ausbildung
gelangten. So hätten wir denn, den muthmasslich irrigen
Ausdruck des Aristoteles bei Seite gesetzt, alles bisher Angeführte,
wie wunderlich es sein mag, wenigstens in sich selbst vollkommen
zusammenhängend und folgerichtig gefunden. Es fragt sich nur
noch, ob ich des Empedokles Meinung über die erste Scheidung
der Elemente richtig errathen habe. Einen directen Beweis dafür
vann ich nicht hefern, vielmehr würde folgende Stelle des Pseudo-
Plutarchos 2), die ich nicht verleugnen will, ein directer Gegenbeweis
sein, wenn sie nicht so offenbare Missverständnisse enthielte,
dass sie dadurch, wie mir scheint, bis auf einen gewissen Punkt
alles Gewicht verliert. Sie lautet so:
„Empedokles (sagte), zuerst hätte sich der Aether abgesondert,
darauf das Feuer, nach diesem die Erde; zusammengeschnürt
durch des Umschwungs Kraft, sei aus ihr das Wasser hervorgequollen,
aus diesem die Luft ausgedünstet. Und der Himmel sei
entstanden aus dem Aether, die Sonne aus dem Feuer, aus den
J ) Brandis a. a. 0. / , S. 202 ff.
3) Plvf. l. c. IT, cap. 6.
B u c h L Kap. 2. §.8. 51
übrigen wären die Dinge der Erdoberfläche zusammengeknetet."
Wäre die Stelle richtig, so hätten wir fünf Wurzeln der Dinge,
Empedokles kennt nur viere; Aether ist bei ihm, wie wir sahen,
gleichbedeutend mit Luft, die Absonderung des Aethers vor dem
Feuer muss also auf einem Missverständniss beruhen. Unterschied
Empedokles vielleicht zuerst einerseits eine noch aus Feuer und
Luft gemischte Atmosphäre, die er vielleicht ätherisch nannte, und
aus der er das Feuer sich aussondern liess; andrerseits einen noch
aus Erde und Wasser gemischten Grund und Boden, aus dem er
später das Wasser hervorquellen liess? Dann wären unter der
aus dem Wasser ausdünstenden Luft die Wolken zu verstehen,
und so jede Schwierigkeit gehoben; doch Hessen sich leicht noch
andere Erklärungen finden, und keine vor den übrigen behaupten.
Die schon gegebene Quellentheorie aber enthält nichts, was
sie verdächtig machte.
Ich komme zu dem zweiten von Nikolaos Damaskenos hervorgehobnen
Hauptpunkt empedokleischer Phytologie: die Pflanzen
besäs sen wie die Thier e Ve r l angen, Gefühl der
L u s t und U n l u s t , j a Verstand und Einsicht. Das klingt
sehr wunderhch, und schon Sextus Empiricus i), nachdem er erzählt,
Herakleitos hätte behauptet, die Menschen wären nicht die
einzigen verständigen Wesen, fährt fort: „noch paradoxer behauptete
Empedokles, al les wär e verständig, nicht allein die Thiere,
sondern auch die Pflanzen, indem er ausdrücklich schrieb:
„Wisse denn, alles erhielt Antheil an Sinn und Verständniss."
Ausser allem Zusammenhange darf indess ein empedokleischer
Satz am wenigsten beurtheilt werden, und bei diesem Satz kommen
zwei tief eingreifende Vorstellungen des Empedokles in Betracht,
seine Vorstellung von der Seele und von der Seelenwanderung.
Ungeachtet der Unterscheidung zweier Grundkräfte von den
vier Wurzeln der Dinge, war Empedokles doch nichts weniger als
Duahst im heutigen Sinne des Worts, sondern jene Grundkräfte
1) Sext. Empir, advers. maihem. VIII, cap. 286. pag. 512. edit. Fabricii.
4*
i.
• m • •• -^i.'.'.i
VH
V
if
- m
's'-
ff
7 iM •= • V
- '
I