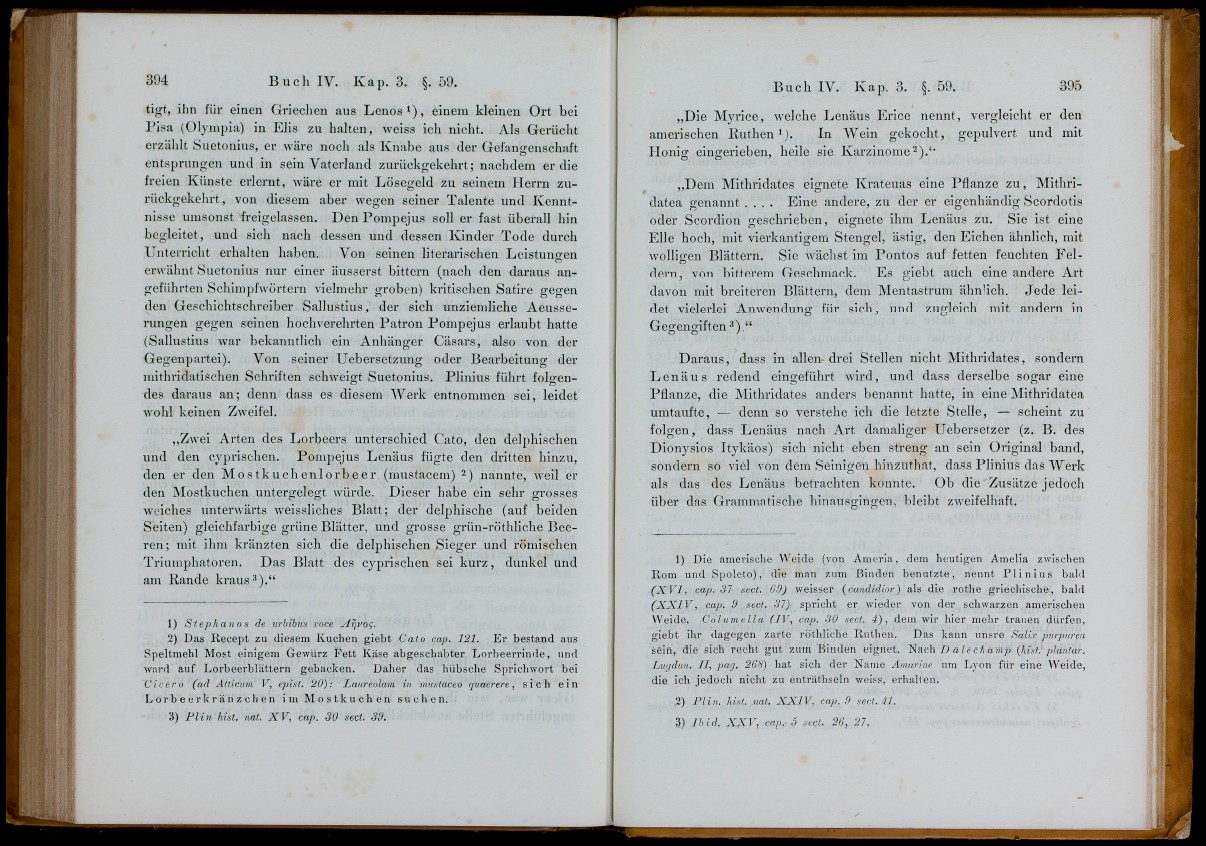
V ' r
i
I
I • !
I''
i i f-
394 B u c h IV. Kap. 3. §. 59.
tigt, ihn für einen Griechen aus Lenos^), einem kleinen Ort bei
Pisa (Olympia) in EHs zu halten, weiss ich nicht. Als Gerücht
erzählt Suetonius, er wäre noch als Knabe aus der Gefangenschaft
entsprungen und in sein Vaterland zurückgekehrt; nachdem er die
freien Künste erlernt, wäre er mit Lösegeld zu seinem Herrn zurückgekehrt,
von diesem aber wegen seiner Talente und Kenntnisse
umsonst freigelassen. Den Pompejus soll er fast überall hin
begleitet, und sich nach dessen und dessen Kinder Tode durch
Unterricht erhalten haben. Von seinen literarischen Leistungen
erwähnt Suetonius nur einer äusserst bittern (nach den daraus angeführten
Schimpfwörtern vielmehr groben) kritischen Satire gegen
den Geschichtschreiber Sallustius, der sich unziemliche Aeusserungen
gegen seinen hochverehrten Patron Pompejus erlaubt hatte
(Sallustius war bekanntlich ein Anhänger Cäsars, also von der
Gegenpartei), Von seiner Uebersetzung oder Bearbeitung der
mithridatischen Schriften schweigt Suetonius. Plinius führt folgendes
daraus an; denn dass es diesem Werk entnommen sei, leidet
wohl keinen Zweifel.
„Zwei Arten des Lorbeers unterschied Cato, den delphischen
und den cyprischen. Pompejus Lenäus fügte den dritten hinzu,
den er den Mos tkuchenlorbe e r (mustacem) nannte, Aveil er
den Mostkuchen untergelegt würde. Dieser habe ein sehr grosses
weiches unterwärts weissliches Blatt; der delphische (auf beiden
Seiten) gleichfarbige grüne Blätter, und grosse grün-röthliche Beeren;
mit ihm kränzten sich die delphischen Sieger und römischen
Triumphatoren. Das Blatt des cyprischen sei kurz, dunkel und
am Rande kraus
1) Stephaiio s de tirhihis voce yL^vog-
2) Das Recept zu diesem Kuchen giebt Cato cap. 121. Er bestand aus
Speltraehl Most einigem Gewürz Fett Käse abgeschabter Lorbeerrinde, und
ward auf Lorbeerblättern gebacken. Daher das hübsche Sprichwort bei
Cicero (ad Atticum V^ epist* 20): Laureolam in mustaceo qvaerere ^ s i c h ein
L o r b e e r k r ä n z c h e n im Mo s t kuche n suchen.
3) Flin hist, nat. XV^ cap, 30 sect. 39.
B u c h IV. Kap. 3. §. 59. 395
„Die Myrice, welche Lenäus Erice nennt, vergleicht er den
amerischen Ruthen In Wein gekocht, gepulvert und mit
Honig eingerieben, heile sie Karzinome^)/'
„Dem Mithridates eignete Krateuas eine Pflanze zu, Mithridatea
genannt . . . . Eine andere, zu der er eigenhändig Scordotis
oder Scordion geschrieben, eignete ihm Lenäus zu. Sie ist eine
Elle hoch, mit vierkantigem Stengel^ ästig, den Eichen ähnlich, mit
wollis:en Blättern. Sie wächst im Pontos auf fetten feuchten Feidem,
von bitterem Geschmack. Es giebt auch eine andere Art
davon mit breiteren Blättern, dem Mentastrum ähnlich. Jede leidet
vielerlei Anwendung für sich, und zugleich mit andern in
Gegengiften^)."
Daraus, dass in allen drei Stellen nicht Mithridates, sondern
L e n ä u s redend eingeführt wird, und dass derselbe sogar eine
Pflanze, die Mithridates anders benannt hatte, in eine Mithridatea
umtaufte, — denn so verstehe ich die letzte Stelle, — scheint zu
folgen, dass Lenäus nach Art damaliger Uebersetzer (z. B, des
Dionysios Itykäos) sich nicht eben streng an sein Original band,
sondern so viel von dem Seinigen hinzuthat, dass Plinius das Werk
als das des Lenäus betrachten konnte. Ob die Zusätze jedoch
über das Grammatische hinausgingen, bleibt zweifelhaft.
1) Die amerische Weide (von Amerla, dem heutigen Amelia zwischen
Rom und Spoleto), die man zum Binden benutzte, nennt Plinius bald
(XVI, cap, 37 sect. 69) weisser (candidior) als die rothe griechische, bald
(XXIV^ cap. 9 sect. 37) spricht er wieder von der schwarzen amerischen
Weide. Columella (IV^ cap. 30 sect. 4), dem wir hier mehr trauen dürfen,
giebt ihr dagegen zarte röthliche Ruthen. Das kann unsre Salix purpurea
sein, die sich recht gut zum Binden eignet. 'N'dch D alechaiJip (Inst, plantar.
Lugdun. //, pag. 268) hat sich der Name Amarine um Lyon für eine Weide,
die ich jedoch nicht zu enträthseln weiss, erhalten,
Plin, hist. nat. XXIV, cap, 9 sect, 41.
3) Ihid, XXV^ cap. 5 sect. 26, 27,