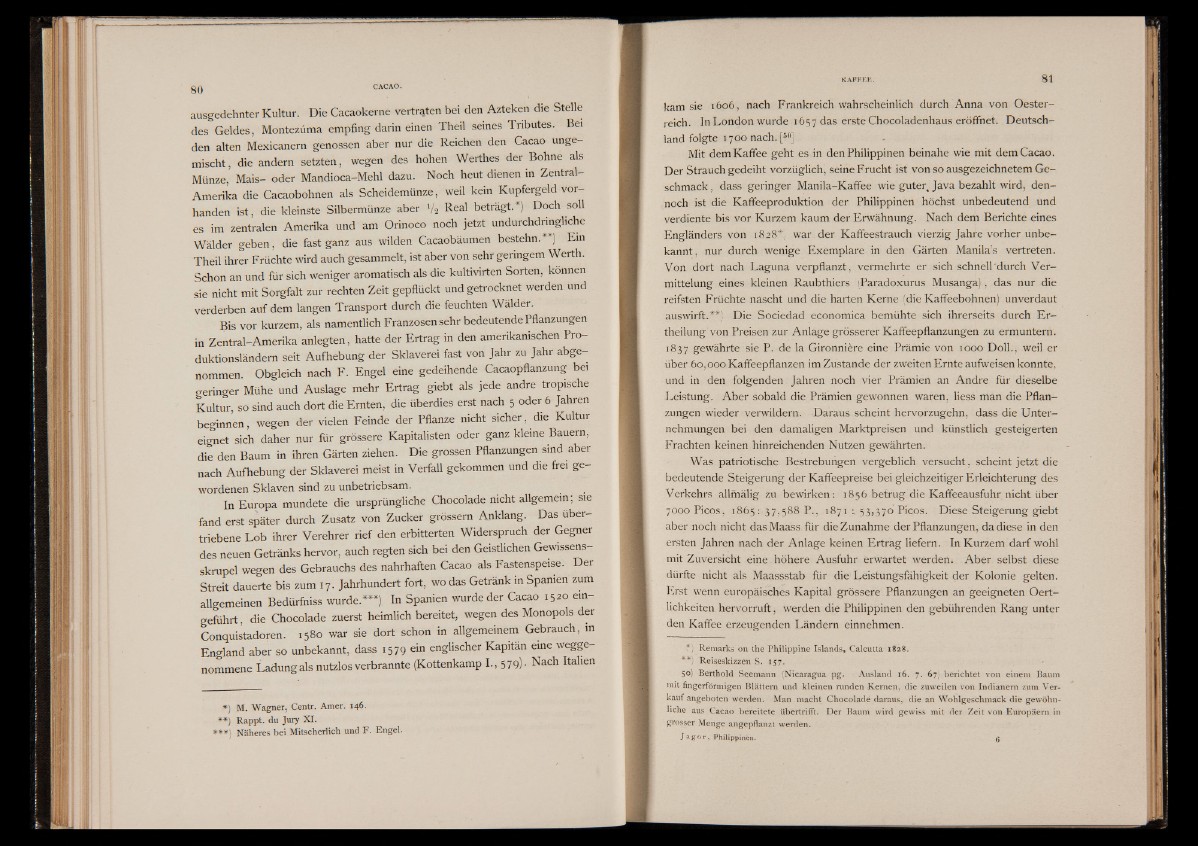
ausgedehnter Kultur. Die Cacaokerne vertraten bei den Azteken die Stelle
des Geldes, Montezüma empfing darin einen Theil seines Tributes. Bei
den alten Mexicanern genossen aber nur die Reichen den Cacao ungemischt,
die ändern setzten, wegen des hohen Werthes der Bohne als
Münze, Mais- oder Mandioca-Mehl dazu. Noch heut dienen in Zentral-
Amerika die Cacaobohnen als Scheidemünze, weil kein Kupfergeld vorhanden
ist, die kleinste Silbermünze aber V2 Real beträgt.*) Doch soll
es im zentralen Amerika und am Orinoco noch jetzt undurchdringliche
Wälder geben, die fast ganz aus wilden Cacaobäumen bestehn.**) Ein
Theil ihrer Früchte wird auch gesammelt, ist aber von sehr geringem Werth.
Schon an und für sich weniger aromatisch als die kultivirten Sorten, können
sie nicht mit Sorgfalt zur rechten Zeit gepflückt und getrocknet werden und
verderben auf dem langen Transport durch die feuchten Wälder.
Bis vor kurzem, als namentlich Franzosen sehr bedeutende Pflanzungen
in Zentral-Amerika anlegten, hatte der Ertrag in den amerikanischen Pro-
duktionsländem seit Aufhebung der Sklaverei fast von Jahr zu Jahr abgenommen.
Obgleich nach F . Engel eine gedeihende Cacaopflanzung bei
geringer Mühe und Auslage mehr Ertrag giebt als jede andre tropische
Kultur, so sind auch dort die Ernten, die überdies erst nach 5 oder 6 Jahren
beginnen, wegen der vielen Feinde der Pflanze nicht sicher, die Kultur
eignet sich daher nur für grössere Kapitalisten oder ganz kleine Bauern,
die den Baum in ihren Gärten ziehen. Die grossen Pflanzungen sind aber
nach Aufhebung der Sklaverei meist in Verfall gekommen und die frei g e -
wordenen Sklaven sind zu unbetriebsam.
In Europa mundete die ursprüngliche Chocolade nicht allgemein; sie
fand erst später durch Zusatz von Zucker grössern Anklang. Das übertriebene
L o b ihrer Verehrer rief den erbitterten Widerspruch der Gegner
des neuen Getränks hervor, auch regten sich bei den Geistlichen Gewissensskrupel
wegen des Gebrauchs des nahrhaften Cacao als Fastenspeise. Der
Streit dauerte bis zum 17. Jahrhundert fort, wo das Getränk in Spanien zum
allgemeinen Bedürfniss wurde.***) In Spanien wurde der Cacao 1520 a n geführt,
die Chocolade zuerst heimlich bereitet, wegen des Monopols der
Conquistadoren. 1580 war sie dort schon in allgemeinem Gebrauch, in
England aber so unbekannt, dass 1579 ein englischer Kapitän eine weggenommene
Ladung als nutzlos verbrannte (Kottenkamp I., 579). Nach Italien
*) M. Wagner, Centr. Amer. 146.
**) Rappt, du Jury XI.
***) Näheres bei Mitscherlich und F. Engel.
kam sie 1606, nach Frankreich wahrscheinlich durch Anna von Oesterreich.
In London wurde 1657 das erste Chocoladenhaus eröffnet. Deutschland
folgte 1700 nach. [50]
Mit dem Kaffee geht es in den Philippinen beinahe wie mit dem Cacao.
Der Strauch gedeiht vorzüglich, seine Frucht ist von so ausgezeichnetem Geschmack
, dass geringer Manila-Kaffee wie guter, Java bezahlt wird, dennoch
ist die Kaffeeproduktion der Philippinen höchst unbedeutend und
verdiente bis vor Kurzem kaum der Erwähnung. Nach dem Berichte eines
Engländers von 1828*; war der Kaffeestrauch vierzig Jahre vorher unbekannt,
nur durch wenige Exemplare in den Gärten Manila’s vertreten.
Von dort nach Laguna verpflanzt, vermehrte er sich schnell'durch V ermittelung
eines kleinen Raubthiers (Paradoxurus Musanga), das nur die
reifsten Früchte nascht und die harten Kerne (die Kaffeebohnen) unverdaut
auswirft.**) Die Sociedad economica bemühte sich ihrerseits durch E r -
theilung von Preisen zur Anlage grösserer Kaffeepflanzungen zu ermuntern.
1837 gewährte sie P. de la Gironniere eine Prämie von 1000 Doll., weil er
über 60,000 Kaffeepflanzen im Zustande der zweiten E rnte aufweisen konnte,
und in den folgenden Jahren noch vier Prämien an Andre für dieselbe
Leistung. Ab e r sobald die Prämien gewonnen waren, liess man die Pflanzungen
wieder verwildern. Daraus scheint hervorzugehn, dass die Unternehmungen
bei den damaligen Marktpreisen und künstlich gesteigerten
Frachten keinen hinreichenden Nutzen gewährten.
Was patriotische Bestrebungen vergeblich versucht, scheint jetzt die
bedeutende Steigerung der Kaffeepreise bei gleichzeitiger Erleichterung des
Verkehrs allmälig zu bewirken: 1856 betrug die Kaffeeausfuhr nicht über
7000 Picos, 1865:37,588 p., 1871 ; 53,370 Picos. Diese Steigerung giebt
aber noch nicht das Maass für die Zunahme der Pflanzungen, da diese in den
ersten Jahren nach der Anlage keinen Ertrag liefern. In Kurzem darf wohl
mit Zuversicht eine höhere Ausfuhr erwartet werden. Ab e r selbst diese
dürfte nicht als Maassstab für die Leistungsfähigkeit der Kolonie gelten.
Erst wenn europäisches Kapital grössere Pflanzungen an geeigneten Oert-
lichkeiten hervorruft, werden die Philippinen den gebührenden Rang unter
den Kaffee erzeugenden Ländern einnehmen.
*) Remarks on the Philippine Islands, Calcutta 1828.
**) Reiseskizzen S. 157.
50) Berthold Seemann (Nicaragua pg. Ausland 16. 7. 67) berichtet von einem Baum
mit fingerförmigen Blättern und kleinen runden Kernen, die zuweilen von Indianern zum Verkauf
angeboten werden. Man macht Chocolade daraus, die an Wohlgeschmack die gewöhnliche
aus Cacao bereitete übertriift. Der Baum wird gewiss mit der Zeit von Europäern in
grösser Menge angepflanzt werden.
J ag o r , Philippinen. g