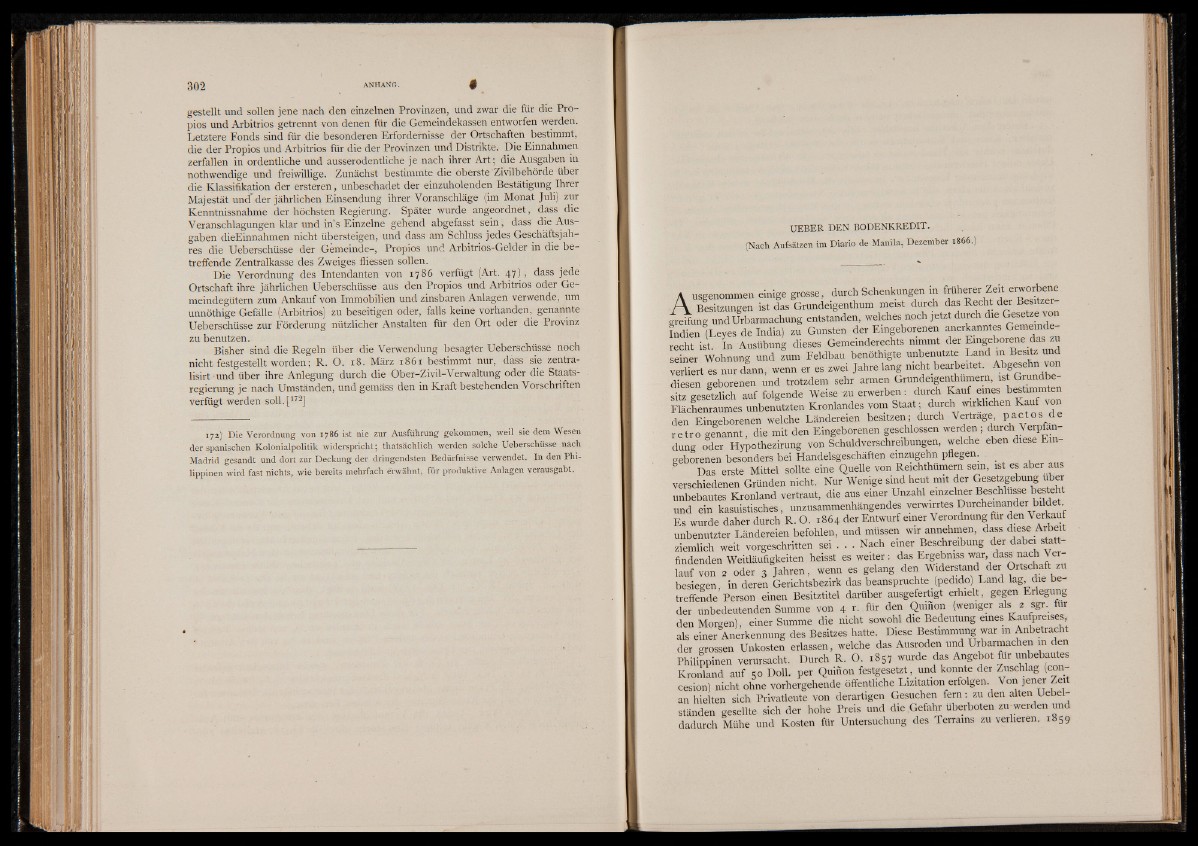
gestellt und sollen jene nach den einzelnen Provinzen, und zwar die für die Pro-
pios und Arbitrios getrennt von denen für die Gemeindekassen entworfen werden.
Letztere Fonds sind für die besonderen Erfordernisse der Ortschaften bestimmt,
die der Propios und Arbitrios für die der Provinzen und Distrikte. Die Einnahmen
zerfallen in ordentliche und ausserodentliche je nach ihrer Art; die Ausgaben in
nothwendige und freiwillige. Zunächst bestimmte die oberste Zivilbehörde über
die Klassifikation der ersteren, unbeschadet der einzuholenden Bestätigung Ihrer
Majestät und' der jährlichen Einsendung ihrer Voranschläge (im Monat Juli) zur
Kenntnissnahme der höchsten Regierung. Später wurde angeordnet, dass die
Veranschlagungen klar und in’s Einzelne gehend abgefasst sein, dass die Ausgaben
dieEinnahmen nicht übersteigen, und dass am Schluss jedes Geschäftsjahres
die Ueberschüsse der Gemeinde-, Propios und Arbitrios-Gelder in die betreffende
Zentralkasse des Zweiges fliessen sollen.
Die Verordnung des Intendanten von 1786 verfügt (Art. 47), dass jede
Ortschaft ihre jährlichen Ueberschüsse aus den Propios und Arbitrios oder Gemeindegütern
zum Ankauf von Immobilien und zinsbaren Anlagen verwende, um
unnöthige Gefälle (Arbitrios) zu beseitigen oder, falls keine vorhanden, genannte
Ueberschüsse zur Förderung nützlicher Anstalten für den Ort oder die Provinz
zu benutzen.
Bisher sind die Regeln über die Verwendung besagter Ueberschüsse noch
nicht festgestellt worden; R. O. 18. März 1861 bestimmt nur, dass sie zentra-
lisirt 'Und über ihre Anlegung durch die Ober-Zivil-Verwaltung oder die Staatsregierung
je nach Umständen, und gemäss den in Kraft bestehenden Vorschriften
verfügt werden soll. [172]
172)1 Die Verordnung von 1786 ist nie zur Ausführung gekommen, weil sie dem Wesen
der spanischen Kolonialpolitik widerspricht; thatsächlich werden solche Ueberschüsse nach
Madrid gesandt und dort zur Deckung der dringendsten Bedürfnisse verwendet. In den Philippinen
wird fast nichts, wie bereits mehrfach erwähnt, für produktive Anlagen verausgabt.
UEBER DEN BODENKREDIT.
(Nach Aufsätzen im Diario de Manila, Dezember 1866.)
A usgenommen einige grosse, durch Schenkungen in früherer Zeit erworbene
Besitzungen ist das Grundeigenthum meist durch das Recht der Besitz«
greffung und Urbarmachung entstanden, welches moch jetzt durch die Gesetze von
Indien (Leyes de India) zu Gunsten der Eingeborenen anerkanntes Gemeinderecht
ist In Ausübung dieses Gemeinderechts nimmt der Eingeborene das zu
seiner Wohnung und zum Feldbau benöthigte unbenutzte Land m Besitz und
verliert es nur dann, wenn er es zwei Jahre lang nicht bearbeitet. Abgesehn von
diesen geborenen und trotzdem sehr armen Grundeigentümern, ist Grundbesitz
gesetzlich auf folgende Weise zu erwerben - durch Kauf eines bestimmten
Flächenraumes unbenutzten Kronlandes vom Staat; durch wirklichen Kauf von
den Eingeborenen welche Ländereien besitzen; durch Vertrage, p a ct o s d
ret ro genannt, die mit den Eingeborenen geschlossen werden; durch Verpfandung
oder Hypothezirung von Schuldverschreibungen, welche eben diese Eingeborenen
besonders bei Handelsgeschäften einzugehn pflegen.
Das erste Mittel sollte eine Quelle von Reichthümern sein, ist es aber aus
verschiedenen Gründen nicht. Nur Wenige sind heut mit der Gesetzgebung über
unbebautes Kronland vertraut, die aus einer Unzahl einzelner Beschlüsse besteht
und ein kasuistisches, unzusammenhängendes verwirrtes Durcheinander bild .
Es wurde daher durch R. O. 1864 der Entwurf einer Verordnung für den Verkauf
unbenutzter Ländereien befohlen, und müssen wir annehmen, dass diese Arbeit
ziemlich weit vorgeschritten sei . . . Nach einer Beschreibung der dabei stattfindenden
Weitläufigkeiten heisst es weiter: das Ergebnis* war, dass nach Verlauf
von 2 oder 3 Jahren, wenn es gelang den Widerstand der Ortschaft zu
besiegen in deren Gerichtsbezirk das beanspruchte (pedido) Land lag die betreffende’Person
einen Besitztitel darüber ausgefertigt erhielt, gegen Erlegung
der unbedeutenden Summe von 4 t- für den Quinon (weniger als 2 sgr. für
den Morgen), einer Summe die nicht sowohl die Bedeutung eines Kaufpreises,
als einer Anerkennung des Besitzes hatte. Diese Bestimmung war in Anbetracht
der grossen Unkosten erlassen, welche das Ausroden und Urbarmachen in den
Philippinen verursacht. Durch R. O. 1857 wurde das Angebot für unbebautes
Kronland auf 50 Doll, per Quinon festgesetzt, und konnte der Zuschlag (con-
cesion) nicht ohne vorhergehende öffentliche Lizitation erfolgen. Von jener Zeit
an hielten sich Privatleute von derartigen Gesuchen fern: zu den alten Uebel-
ständen eesellte sich der hohe Preis und die Gefahr überboten zu-werden und