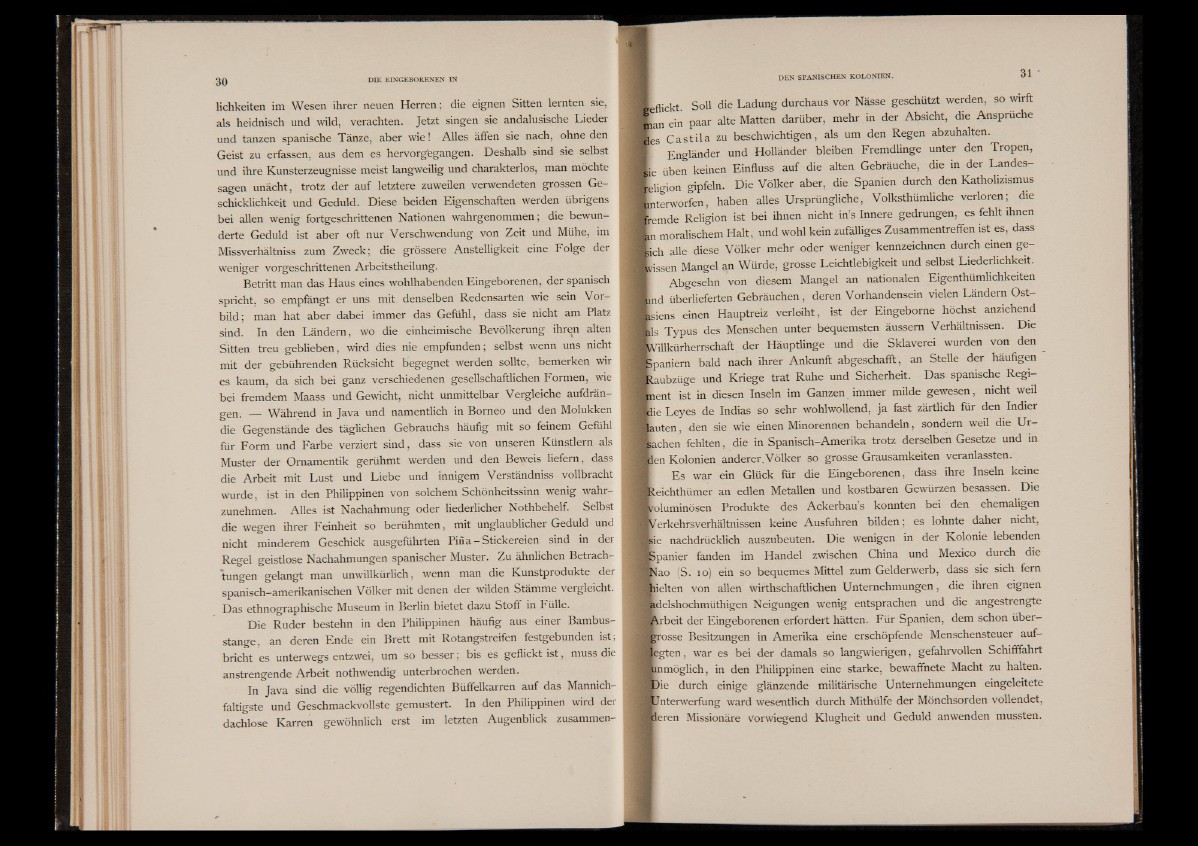
lichkeiten im Wesen ihrer neuen Herren; die eignen Sitten lernten sie,
als heidnisch und wild, verachten. Jetzt singen sie andalusische Lieder
und tanzen spanische Tänze, aber w ie ! Alles äffen sie nach, ohne den
Geist zu erfassen, aus dem es hervorg'egangen. Deshalb sind sie selbst
und ihre Kunsterzeugnisse meist langweilig und charakterlos, man möchte
sagen unächt, trotz der auf letztere zuweilen verwendeten grossen Geschicklichkeit
und Geduld. Diese beiden Eigenschaften werden übrigens
bei allen wenig fortgeschrittenen Nationen wahrgenommen; die bewunderte
Geduld ist aber oft nur Verschwendung von Zeit und Mühe, im
Missverhältniss zum Zweck; die grössere Anstelligkeit eine F o lg e der
weniger vorgeschrittenen Arbeitstheilung.
Betritt man das Haus eines wohlhabenden Eingeborenen, der spanisch
spricht, so empfängt er uns mit denselben Redensarten wie sein V o r bild;
man hat aber dabei immer das Gefühl, dass sie nicht am Platz
sind. In den Ländern, wo die einheimische Bevölkerung ihren alten
Sitten treu geblieben, wird dies nie empfunden; selbst wenn uns nicht
mit der gebührenden Rücksicht begegnet werden sollte, bemerken wir
es kaum, da sich bei ganz verschiedenen gesellschaftlichen Formen, wie
bei fremdem Maass und Gewicht, nicht unmittelbar Vergleiche aufdrängen.
— Während in Java und namentlich in Borneo und den Molukken
die Gegenstände des täglichen Gebrauchs häufig mit so feinem Gefühl
für Form und Farbe verziert sind, dass sie von unseren Künstlern als
Muster der Ornamentik gerühmt werden und den Beweis liefern, dass
die Arbeit mit Lust und Liebe und innigem Verständniss vollbracht
. jst jji den Philippinen von solchem Schönheitssinn wenig wahr—
zunehmen. Alles ist Nachahmung oder liederlicher Nothbehelf. Selbst
die wegen ihrer Feinheit so berühmten, mit unglaublicher Geduld und
nicht minderem Geschick ausgeführten Pina - Stickereien sind in der
Regel geistlose Nachahmungen spanischer Muster. Zu ähnlichen Betrachtungen
gelangt man unwillkürlich, wenn man die Kunstprodukte der
spanisch-amerikanischen Völker mit denen der wilden Stämme vergleicht.
Das ethnographische Museum in Berlin bietet dazu S to ff in Fülle.
Die Ruder bestehn in den Philippinen häufig aus einer Bambusstange,
an deren Ende ein Brett mit Rotangstreifen festgebunden ist;
bricht es unterwegs entzwei, um so b e s se r ; bis es geflickt i s t, muss die
anstrengende Arbeit nothwendig unterbrochen werden.
In Java sind die völlig regendichten Büffelkarren auf das Mannich-
faltigste und Geschmackvollste gemustert. In den Philippinen wird der
dachlose Karren gewöhnlich erst im letzten Augenblick zusammen-
^fcflickt. Soll die Ladung durchaus vor Nässe geschützt werden, so wirft
^ B a n e in paar alte Matten darüber, mehr in der Absicht, die Ansprüche
■ C a s t i l a zu beschwichtigen, als um den Regen abzuhalten.
■ Engländer und Holländer bleiben Fremdlinge unter den Tropen,
l l i e üben keinen Einfluss auf die alten Gebräuche, die in der L an d e s -
B e lim o n gipfeln. Die Völke r aber, die Spanien durch den Katholizismus
U n te rw o r fe n , haben alles Ursprüngliche, V o lk s tüm lich e verloren; die
H tem d e Religion ist bei ihnen nicht in’s Innere gedrungen, es fehlt ihnen
Kn moralischem Halt, und wohl kein zufälliges Zusammentreffen ist es, dass
K c h alle diese Völke r mehr oder weniger kennzeichnen durch einen gewissen
Mangel an Würde, grosse Leichtlebigkeit und selbst Liederlichkeit.
Abgesehn von diesem Mangel an nationalen Eigenthümlichkeiten
und überlieferten Gebräuchen, deren Vorhandensein vielen Ländern O s t-
K s i e n s einen Hauptreiz verleiht, ist der Eingeborne höchst anziehend
K l s Typus des Menschen unter bequemsten äussern Verhältnissen. Die
Kv illkü rhe rrschaft der Häuptlinge und die Sklaverei wurden von den
fP p a n iem bald nach ihrer Ankunft abgeschafft, an Stelle der häufigen
K ^ au bzü g e und Kriege trat Ruhe und Sicherheit. Das spanische R e g i-
ment ist in diesen Inseln im Ganzen immer milde gewesen, nicht weil
K l i e Leyes de Indias so sehr wohlwollend, ja fast zärtlich für den Indier
B a u t e n , den sie wie einen Minorennen behandeln, sondern weil die Ur—
sachen fehlten, die in Spanisch-Amerika trotz derselben Gesetze und in.
JSlen Kolonien anderer,Völker so grosse Grausamkeiten veranlassten.
Es war ein Glück für die Eingeborenen, dass ihre Inseln keine
||Reichthümer an edlen Metallen und kostbaren Gewürzen besassen. Die
^voluminösen Produkte des Ackerbau’s konnten bei den ehemaligen
erkehrsVerhältnissen keine Ausfuhren b ild en ; es lohnte daher nicht,
^ v ie nachdrücklich auszubeuten. Die wenigen in der Kolonie lebenden
K>panier fanden im Handel zwischen China und Mexico durch die
SBvIao (S. io) ein so bequemes Mittel zum Gelderwerb, dass sie sich fern
iiielten von allen wirthschaftlichen Unternehmungen, die ihren eignen
|fcdelshochmüthigen Neigungen wenig entsprachen und die angestrengte
JvVrbeit der Eingeborenen erfordert hätten. Für Spanien, dem schon über—
B r r o s s e Besitzungen in Amerika eine erschöpfende Menschensteuer auf—
^ f c g t e n , war es bei der damals so langwierigen, gefahrvollen Schifffahrt
^ unmö glich , in den Philippinen eine starke, bewaffnete Macht zu halten.
MJ ie durch einige glänzende militärische Unternehmungen eingeleitete
¿■Unterwerfung ward wesentlich durch Mithülfe der Mönchsorden vollendet,
M ie ren Missionäre vorwiegend Klugheit und Geduld anwenden mussten.