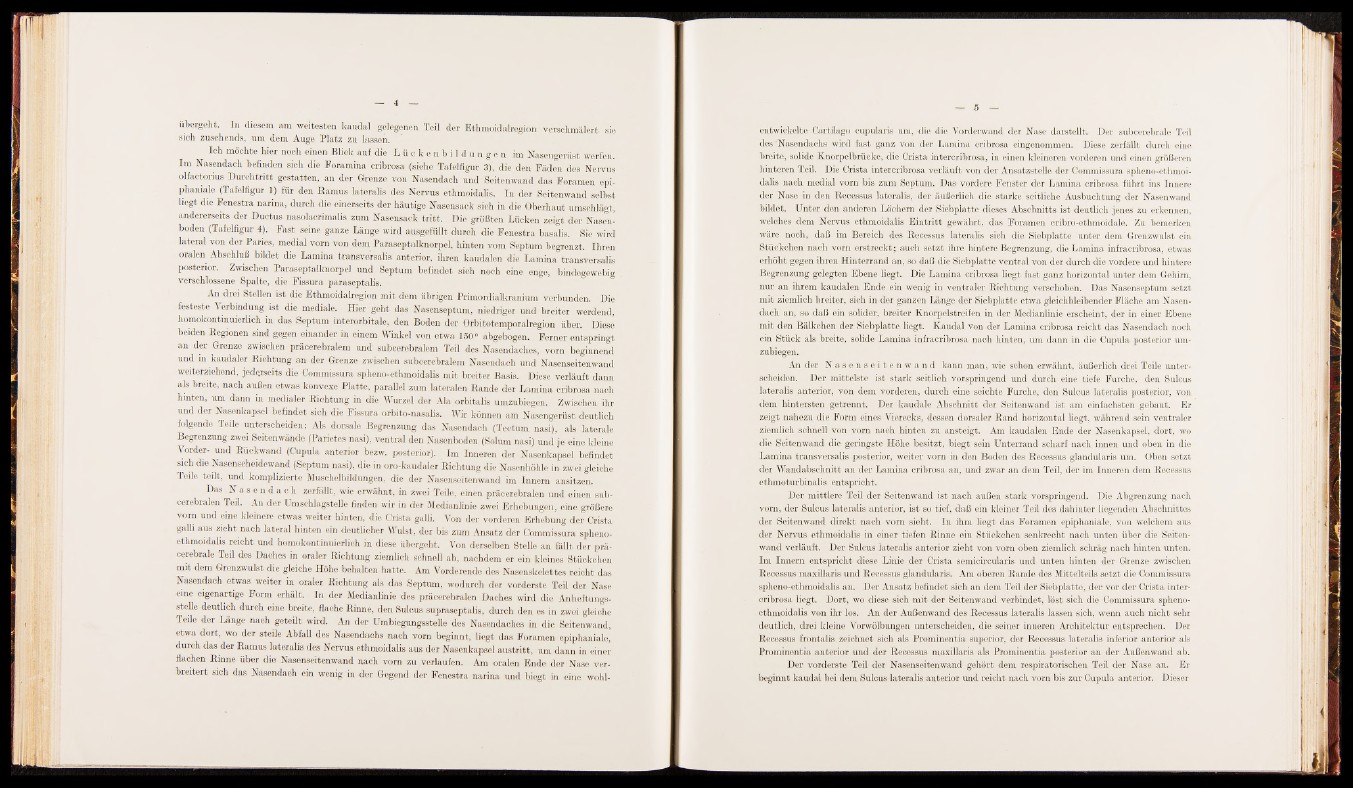
übergellt: In diesem am weitesten kaudal gelegenen Teil der Ethmoidalregion verschmälert sie
sich zusehends, um dem Auge Platz zu lassen.
Ich möchte hier noch einen Blick auf die L ü c k e n b i l d u n g e n im Nasengerüst werfen.
Im Nasendaoh befinden sich die Foramina cribrosa (siehe Tafelfigur 3), die den Fäden des Nervus
olfactorius D urchtritt gestatten, an der Grenze von Nasendach und Seitenwand das Foramen epi-
phaniale (Tafelfigur 1) für den Eamus lateralis des Nervus ethmoidalis. In der Seitenwand seihst
liegt die Fenestra narina, durch die einerseits der häutige Nasensack sich in die Oberhaut umschlägt;
andererseits der Ductus nasolacrimalis zum Nasensack tritt. Die größten Lücken zeigt der Nasenboden
(Tafelfigur 4). F a st seine ganze Länge wird ausgefüllt durch die Fenestra basalis. Sie wird
lateral von der Paries, medial vom von dem Paraseptalknorpel, hinten vom Septum begrenzt. Ihren
oralen Abschluß bildet die Lamina transversalis anterior, ihren kaudalen die Lamm« transversalis
posterior. Zwischen Paraseptalknorpel und Septum befindet sich noch eine enge, bindegewebig
verschlossene Spalte, die Fissura paraseptalis.
An drei Stellen ist die Ethmoidalregion mit dem übrigen Primordialkranium verbunden. Die
. festeste Verbindung ist die mediale. Hier geht das Nasenseptum, niedriger und breiter w e rd e n »
homokontinuierlich in das Septum interorbitale, den Boden der Orbitotemporalregion über. D ie |f
beiden Regionen sind gegen einander in einem Winkel von etwa 150» abgebogen. Ferner entspringt
an der Grenze zwischen präcerebralem und subcerebralem Teil des Nasendaches, .Vorn beginnend
und in kaudaler Richtung an der Grenze zwischen subcerebralem Nasendach und Nasenseitenwand
weiterziehend, jedwseits die Commissura spheno-ethmoidalis m it breiter Basis. Diese verläuft dann
als breite, nach außen etwas konvexe Platte, parallel zum lateralen Rande der Lamina cribrosa nach
hinten, um dann in medialer Richtung in die Wurzel der Ala orbitalis umzubiegen. Zwischen i%>
und der Nasenkapsel befindet sich die Fissura orbito-nasalis. Wir können am Nasengerüst deutlich
folgende Teile unterscheiden: Als dorsale Begrenzung das Nasendach (Tectum nasi). als laterale
Begrenzung zwei Seitenwände (Parietes nasi), ventral den Nasenboden (Solum nasi) und je eine t-lem«
-Vorder- und Rückwand (Cupula anterior bezw. posterior). Im Inneren der Nasenkapsel befindet
sich die Nasenscheidewand (Septum nasi), die in oro-kaudaler Richtung die Nasenhöhle in zwei gleiche
Teile teilt, und komplizierte Muschelbildungen, die der Nasenseitenwand im Innern «usit.^r,
Das . N a s e n d a e h zerfällt, wie erwähnt, in zwei Teile, einen präcerebralem und einen subcerebralen
Teil. An der Umschlagstelle finden wir in der Medianlinie zwei Erhebungen, eine größere
vom und eine kleinere etwas weiter hinten, die Crista galli. Von der vorderen Erhebung der Crista
galli.aus zieht nach lateral hinten ein deutlicher Wulst, der bis zum Ansatz der Commissura spheno-
ethmoidalis reicht und homokontinuierlich in diese übergeht. Von derselben Stelle an fällt der p rä cerebrale
Teil des Daches in oraler Richtung ziemlich schnell ab, nachdem er ein kleines Stückchen
mit dem Grenzwulst die gleiche Höhe behalten hatte. Am Vorderende des Nasenskelettes reicht das
Nasendach etwas weiter in oraler Richtung als das Septum, wodurch der vorderste Teil der Nase
eine eigenartige Form erhält. In der Medianlinie des präcerebralen Daches wird die Anheftungsstelle
deutlich durch eine breite, flache R inne, den Sulcus supraseptalis, durch den es in zwei gleiche
Teile der Länge nach geteilt wird. An deriUmbiegungsstelle des Nasendaches in die Seitenwand,
etwa dort, wo der steile Abfall des Nasendachs nach vom beginnt, liegt das Foramen epiphaniale,
durch das der Ramus lateralis des Nervus ethmoidalis aus der Nasenkapsel austritt, um dann in einer
flachen Rinne über die Nasenseitenwand nach vom zu^verlaufen. Am oralen Ende der Nase verbreitert
sich das Nasendach ein wenig in der Gegend der Fenestra narina und biegt in eine wohlentwickelte
Cartilago cupularis um, die die Yorderwand der Nase darstellt. Der subcerebrale Teil
des 'Nasendacbs wird fast ganz von der Lamina cribrosa eingenommen. Diese zerfällt durch eine
breite, solide Knorpelbrücke, die Crista intercribrosa, in einen kleineren vorderen und einen größeren
hinteren Teil. Die Crista intercribrosa verläuft von der Ansatzstelle der Commissura spheno-ethmoidalis
nach medial vorn bis zum Septum. Das vordere Fenster der Lamina cribrosa führt ins Innere
der Nase in den Recessus lateralis, der äußerlich die starke seitliche Ausbuchtung der Nasenwand
bildet. Unter den anderen Löchern der Siebplatte dieses Abschnitts ist deutlich jenes zu erkennen,
welches dem Nervus ethmoidalis E in tritt gewährt, das Foramen cribro-ethmoidale. Zu bemerken
wäre noch, daß im Bereich des Recessus lateralis sich die Siebplatte unter dem Grenzwulst ein
Stückchen nach vorn erstreckt; auch setzt ihre hintere Begrenzung, die Lamina infracribrosa, etwas
erhöht gegen ihren Hinterrand an, so daß die Siebplatte v entral von der durch die vordere und hintere
Begrenzung gelegten Ebene liegt. Die Lamina cribrosa liegt fast ganz horizontal unter dem Gehirn,
nur an ihrem kaudalen Ende ein wenig in ventraler Richtung verschoben. Das Nasenseptum setzt
mit ziemlich breiter, sich in der ganzen Länge der Siebplatte etwa gleichbleibender Fläche am Nasendach
an, so daß ein solider, breiter Knorpelstreifen in der Medianlinie erscheint, der in einer Ebene
mit den Bälkchen der Siebplatte liegt. Kaudal von der Lamina cribrosa reicht das Nasendach noch
ein Stück als breite, solide Lamina infracribrosa nach hinten, um dann in die Cupula posterior umzubiegen.
An der N a s e n s e i t e n w a n d kann man, wie schon erwähnt, äußerlich drei Teile unterscheiden.
Der mittelste ist stark seitlich vorspringend und durch eine tiefe Furche, den Sulcus
lateralis anterior, von dem vorderen, durch eine seichte Furche, den Sulcus lateralis posterior, von
dem hintersten getrennt. Der kaudale Abschnitt der Seitenwand ist am einfachsten gebaut. Er
zeigt nahezu die Form eines Vierecks, dessen dorsaler Rand horizontal liegt, während sein ventraler
ziemlich schnell von vorn nach hinten zu ansteigt. Am kaudalen Ende der Nasenkapsel, dort, wo
die Seitenwand die geringste Höhe besitzt, biegt sein Unterrand scharf nach innen und oben in die
Lamina transversalis posterior, weiter vorn in den Boden des Recessus glandularis um. Oben setzt
der Wandabschnitt an der Lamina cribrosa an, und zwar an dem Teil, der im Inneren dem Recessus
ethmoturbinalis entspricht.
Der mittlere Teil der Seitenwand ist nach außen stark vorspringend. Die Abgrenzung nach
vorn, der Sulcus lateralis anterior, ist so tief, daß ein kleiner Teil des dahinter liegenden Abschnittes
der Seitenwand direkt nach vorn sieht. In ihm liegt das Foramen epiphaniale, von welchem aus
der Nervus ethmoidalis in einer tiefen Rinne ein Stückchen senkrecht nach unten über die Seitenwand
verläuft. Der Sulcus lateralis anterior zieht von vorn oben ziemlich schräg nach hinten unten.
Im Innern entspricht diese Linie der Crista semicircularis und unten hinten der Grenze zwischen
Recessus maxillaris und Recessus glandularis. Am oberen Rande des Mittelteils setzt die Commissura
spheno-ethmoidalis an. Der Ansatz befindet sich an dem Teil der Siebplatte, der vor der Crista intercribrosa
liegt. Dort, wo diese sich mit der Seitenwand verbindet, löst sich die Commissura spheno-
ethmoidalis von ihr los. An der Außenwand des Recessus lateralis lassen sich, wenn auch nicht sehr
deutlich, drei kleine Yorwölbungen unterscheiden, die seiner inneren Architektur entsprechen. Der
Recessus frontalis zeichnet sich als Prominentia superior, der Recessus lateralis inferior anteriör als
Prominentia anterior und der Recessus maxillaris als Prominentia posterior an der Außenwand ab.
Der vorderste Teil der Nasenseitenwand gehört dem respiratorischen Teil der Nase an. Er
beginnt kaudal bei dem Sulcus lateralis anterior und reicht nach vorn bis zur Cupula anterior. Dieser