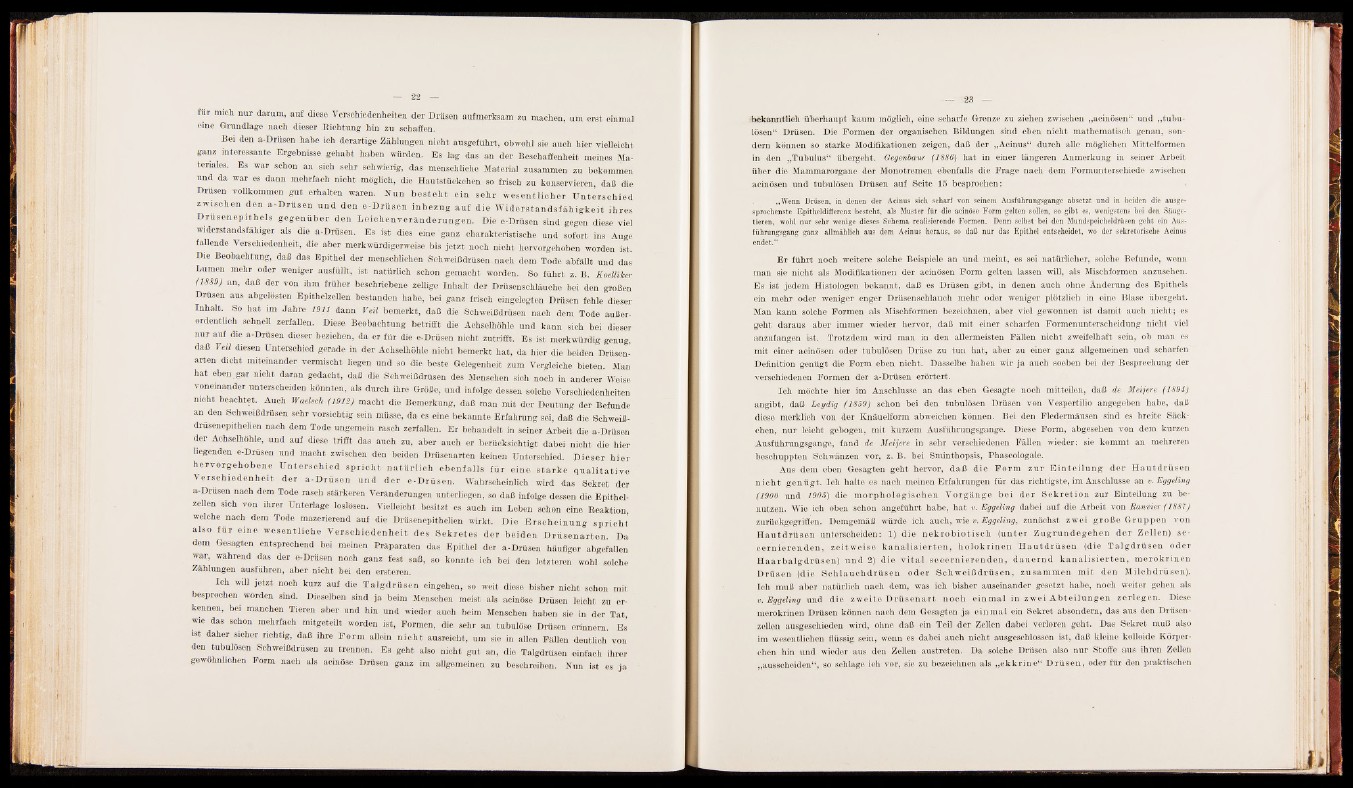
für mich nur darum, auf diese Verschiedenheiten der Drüsen aufmerksam zu machen, um erst einmal
eine Grundlage nach dieser Richtung hin zu schaffen.
Bei den a-Drüsen habe ich derartige Zählungen nicht ausgeführt, obwohläiie auch hier vielleicht
ganz interessante Ergebnisse gehabt haben würden. Es lag das an der Beschaffenheit meines Materiales.
Es war schon an sich sehr schwierig, das menschliche Material zusammen zu bekommen
und da war es dann mehrfach nicht möglich, die Hautstückchen so frisch zu konservieren, daß die
Drüsen vollkommen gut erhalten waren. Nun b e s te h t ein sehr w e sen tlich e r U n te r sch ied
zw isch en den a-Drüsen und den e-Drüsen in b ezu g auf die W id e r sta n d s fä h ig k e it ihres
D rü sen ep ith e ls geg en übe r den Leich en v eränd erun g en . Die e-Drüsen sind gegen diese viel
widerstandsfähiger als die a-Drüsen. Es ist dies eine ganz charakteristische und sofort ins Auge
fallende Verschiedenheit, die aber merkwürdigerweise bis jetzt no_eh nicht hervorgehoben worden ist.
Die Beobachtung, daß das Epithel der menschlichen Schweißdrüsen,nach dem Tode abfällt und das
Lumen mehr oder weniger ausfüllt, ist natürlich schon gemacht worden. So führt z. B. Koelliker
(1889) an, daß der von ihm früher beschriebene zellige Inhalt der Drüsenschläuche bei den großen
Drüsen aus abgelösten Epithelzellen bestanden habe, bei ganz frisch eingelegten Drüsen fehle dieser
Inhalt. So hat im Jahre 1911 daun Veil bemerkt, daß die Schweißdrüsen nach dem Tode außerordentlich
schnell zerfallen. Diese Beobachtung betrifft die Achselhöhle und kann sich bei dieser
§8 ” anf die a-Drilsen dieser beziehen, da er für die e-Drüsen nicht zutrifft. Es ist merkwürdig genug
daß Veil diesen Unterschied gerade in der Achselhöhle nicht bemerkt hat, da hier die beiden Brüsen-
arten dicht miteinander vermischt liegen und so die beste Gelegenheit zum Vergleiche bieten. Man
hat eben gar nicht daran gedacht, daß die Schweißdrüsen des Menschen sich noch in anderer Weise
voneinander unterscheiden könnten, als durch ihre Größe, und infolge dessen solche Verschiedenheiten
nicht beachtet. Auch Waelsch (1912) macht die Bemerkung, daß man mit der Deutung der Befunde
an den Schweißdrüsen sehr vorsichtig sein müsse, da es eine bekannte Erfahrung sei; daß die Schweiß-
drüsenepithelien nach dem Tode ungemein rasch zerfallen. Er behandelt in seiner Arbeit die a-Drüsen
der Achselhöhle, und auf diese trifft das auch zu, aber auch er berücksichtigt dabei nicht die hier
liegenden e-Drüsen und macht zwischen den beiden Drüsenarten keinen Unterschied. D ie se r hier
herv o rg eh ob en e U n te r sch ied sp r ich t n a tü r lich eb en fa lls fü r eine, sta rk e q u a lita tiv e
V e r s ch ied en h e it der a-D rü sen und der e-Drüsen* Wahrscheinlich wird das Sekret der
a-Drusen nach dem Tode rasch stärkeren Veränderungen unterliegen, so daß infolge dessen die Epithelzellen
sich von ihrer Unterlage loslösen. VieUeicht besitzt es auch im Leben schon eine Beaktion,
welche nach dem Tode mazerierend auf die Drüsenepithelien wirkt. Die E r sch e in u n g sp r ich t
also fü r e in e w e sen tlich e V e r s ch ied en h e it des S ek r e te s der beiden Drüsenar ten. Da
dem Gesagten entsprechend bei meinen Präparaten das Epithel der a-Drüsen häufiger abgefallen
war, während das der e-Drüsen noch ganz fest saß, so konnte ich bei den letzteren wohl solche
Zählungen ausführen, aber nicht bei den ersteren.
Ich will jetzt noch kurz auf die Talgdrüsen eingehen, so weit diese bisher nicht schon mit
besprochen worden sind. Dieselben sind ja beim Menschen meist als acinöse Drüsen leicht .zn erkennen,
bei manchen Tieren aber und hin und wieder auch beim Menschen haben sie in der Tat
wie das schon mehrfach mitgeteilt worden ist, Formen, die sehr an tubulöse Drüsen erinnern.. Es
ist daher sicher richtig, daß ihre Form allein n ic h t ausreicht, um sie in allen Fällen deutlich von
den tubulösen Schweißdrüsen zu trennen. Es geht also nicht gut an, die Talgdrüsen einfach ihrer
gewöhnlichen Form nach als acinöse Drüsen ganz im allgemeinen zu beschreiben. Hun ist es ja
bekanntlich überhaupt kaum möglich, eine scharfe Grenze zu ziehen zwischen „acinösen“ und „tubulösen“
Drüsen. Die Formen der organischen Bildungen sind eben nicht mathematisch genau, sondern
können so starke Modifikationen zeigen, daß der „Acinus“ durch alle möglichen Mittelformen
in den „Tubulus“ übergeht, v Gegenbaur (1886) hat in einer längeren Anmerkung in seiner Arbeit
über die Mammarorgane der Monotremen ebenfalls die Frage nach dem Formunterschiede zwischen
acinösen und tubulösen Drüsen auf Seite 15 besprochen:
„Wenn Drüsen, in denen der Acinus sich scharf von seinem Ausführungsgange absetzt und in beiden die ausgesprochenste
Epitheldifferenz besteht, als Muster für die acinöse Form gelten sollen, so gibt es, wenigstens bei den Säugetieren,
wohl nur sehr wenige dieses Schema realisierende Formen. Denn selbst bei den Mundspeicheldrüsen geht ein Ausführungsgang
ganz allmählich aus dem Acinus heraus, so daß nur das Epithel entscheidet, wo der sekretorische Acinus
endet.“
Er führt noch weitere solche Beispiele än und meint, es sei natürlicher, solche Befunde, wenn
man sie nicht als Modifikationen der acinösen Form gelten lassen will, als Mischformen anzusehen.
Es ist jedem Histologen bekannt, daß es Drüsen gibt, in denen auch ohne Änderung des Epithels
ein mehr oder weniger enger Drüsenschlauch mehr oder weniger plötzlich in eine Blase übergeht.
Mari lra.nn solche Formen als Mischformen bezeichnen, aber viel gewonnen ist damit auch nicht; es
geht daraus aber immer wieder hervor, daß mit einer scharfen Formenunterscheidung nicht viel
anzufangen ist; Trotzdem wird man in den allermeisten Fällen nicht zweifelhaft sein, ob man es
mit einer acinösen oder tubulösen Drüse zu tun hat, aber zu einer ganz allgemeinen und scharfen
Definition genügt die Form eben nicht. Dasselbe haben wir ja auch soeben bei der Besprechung der
verschiedenen Formen der a-Drüsen erörtert.
Ich möchte hier im Anschlüsse an das eben Gesagte noch mitteilen, daß de Meijere (1894)
angibt, daß Leydig (1859) schon bei den tubulösen Drüsen von Vespertilio angegeben habe, daß
diese merklich von der Knäuelform ab weichen können. Bei den Fledermäusen sind es breite Säckchen,
nur leicht gebogen, mit kurzem Ausführungsgange. Diese Form, abgesehen von dem kurzen
Ausführungsgange, fand de Meijere in sehr verschiedenen Fällen wieder: sie kommt an mehreren
beschuppten Schwänzen vor, z. B. bei Sminthopsis, Phascologale.
Aus dem eben Gesagten geht hervor, daß die Form zur E in te ilu n g der Hautdrüsen
n ich t genügt. Ich halte es nach meinen Erfahrungen für das richtigste, im Anschlüsse an v.Eggeling
(1900 und 1905) die mo rp h o lo g isch en Vorgänge bei der Sek r e tion zur Einteilung zu benutzen.
Wie ich oben schon angeführt habe, hat v. Eggeling dabei auf die Arbeit von Ranvier (1887)
zurückgegriffen. Demgemäß würde ich auch, wie v. Eggeling, zunächst zwei große Gruppen von
Hau td rü sen unterscheiden: 1) die n ek r o b io tisch (unter Zugrundegehen der Zellen) se-
cern ier en d en , z e itw e ise k a n a lisie r te n , h olok rinen Hautdrüsen (die Talgdrüsen oder
Haarbalgdrüsen) und 2) die v it a l sec e rn ie ren d en , dauernd k a n a lisie r ten , merokrinen
Drüsen (die S chlau ch drüsen oder Schw e iß d rü sen , zusammen mit den Milchdrüsen).
Ich muß aber natürlich nach dem, was ich bisher auseinander gesetzt habe, noch weiter gehen als
v. Eggeling und die zw e ite D rü sen a r t noch e inmal in zw ei A b te ilu n g en zerlegen. Diese
merokrinen Drüsen können nach dem Gesagten ja einmal ein Sekret absondern, das aus den Drüsenzellen
ausgeschieden wird, ohne daß ein Teil der Zellen dabei verloren geht. Das Sekret muß also
im wesentlichen flüssig sein, wenn es dabei auch nicht ausgeschlossen ist, daß kleine kolloide Körperchen
hin und wieder aus den Zellen austreten. Da solche Drüsen also nur Stoffe aus ihren Zellen
„ausscheiden“, so schlage ich vor, sie zu bezeichnen als „ekkrine“ D rüsen, oder für den praktischen