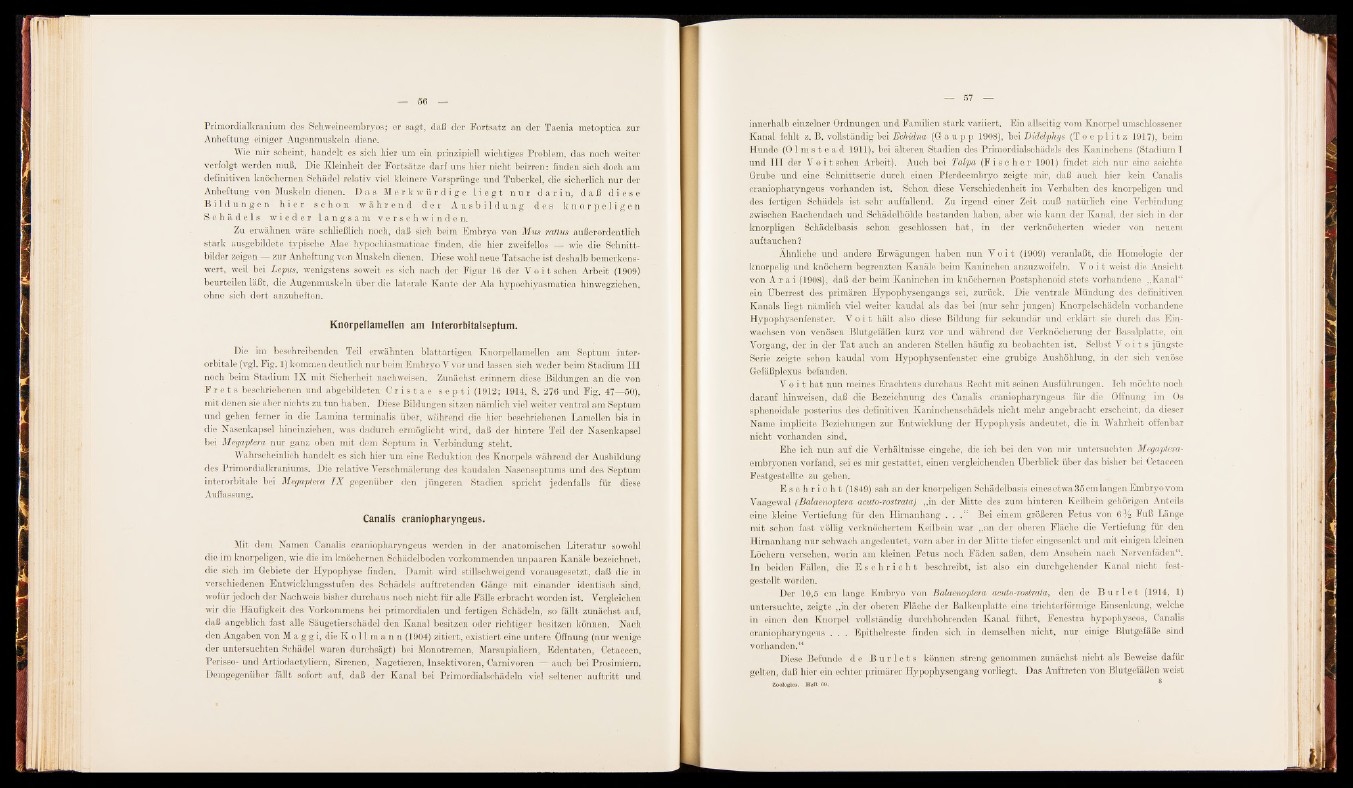
Primordialkranium des Schweineembryos; er sagt, daß der Fortsatz an der Taenia metoptica zur
Anheftung einiger Augenmuskeln diene.
Wie mir scheint, handelt es sich hier um ein prinzipiell wichtiges Problem, das noch weiter
verfolgt werden muß. Die Kleinheit der Fortsätze darf uns hier nicht beirren: finden sich doch am
definitiven knöchernen Schädel relativ viel kleinere Vorsprünge und Tuberkel, die sicherlich nur der
Anheftung von Muskeln dienen. D a s M e r k w ü r d i g e l i e g t n u r d a r i n , d a ß d i e s e
B i l d u n g e n h i e r s c h o n w ä h r e n d d e r A u s b i l d u n g d e s k n o r p e l i g e n
S c h ä d e l s w i e d e r l a n g s a m v e r s c h w i n d e n .
Zu erwähnen wäre schließlich noch, daß sich beim Embryo von Mus rattus außerordentlich
s tark ausgebildete typische Alae hypochiasmaticae finden, die hier zweifellos — wie die Schnittbilder
zeigen — zur Anheftung von Muskeln dienen. Diese wohl neue Tatsache ist deshalb bemerkenswert,
weil bei Lepus, wenigstens soweit es sich nach der Figur 16 der V o i t sehen Arbeit (1909)
beurteilen läßt, die Augenmuskeln über die laterale Kante der Ala hypochiyasmatica hinwegziehen,
ohne sich dort anzuheften.
Knorpellamellen am Interorbitalseptum.
Die im beschreibenden Teil erwähnten blattartigen Knorpellamellen am Septum inte rorbitale
(vgl. Fig. 1) kommen d eutlich nur beim Embryo V vor und lassen sich weder beim Stadium I I I
noch beim Stadium IX mit Sicherheit nachweisen. Zunächst erinnern diese Bildungen an die von
F r e t s beschriebenen und abgebildeten C r i s t a e s e p t i (1912; 1914, S. 276 und Fig. 47—50),
mit denen sie aber nichts zu tu n haben. Diese Bildungen sitzen nämlich viel weiter ventral am Septum
und gehen ferner in die Lamina terminalis über, während die hier beschriebenen Lamellen bis in
die Nasenkapsel hineinziehen, was dadurch ermöglicht wird, daß der hintere Teil der Nasenkapsel
bei Megaptera nur ganz oben mit dem Septum in Verbindung steht.
Wahrscheinlich handelt es sich hier um eine Reduktion des Knorpels während der Ausbildung
des Primordialkraniums. Die relative V erschmälerung des kaudalen Nasenseptums und des Septum
interorbitale bei Megaptera I X gegenüber den jüngeren Stadien spricht jedenfalls für diese
Auffassung.
Canalis craniopharyngeus.
Mit dem Namen Canalis craniopharyngeus werden in der anatomischen Literatur sowohl
die im knorpeligen, wie die im knöchernen Schädelboden vorkommenden unpaaren Kanäle bezeichnet,
die sich im Gebiete der Hypophyse finden. Damit wird stillschweigend vorausgesetzt, daß die in
verschiedenen Entwicklungsstufen des Schädels auftretenden Gänge mit einander identisch sind,
wofür jedoch der Nachweis bisher durchaus noch nicht für alle Fälle erbracht worden ist. Vergleichen
wir die Häufigkeit des Vorkommens bei primordialen und fertigen Schädeln, so fällt zunächst auf,
daß angeblich fast alle Säugetierschädel den Kanal besitzen oder richtiger besitzen können. Nach
den Angaben von M a g g i , die K o l l m a n n (1904) zitiert, existiert eine untere Öffnung (nur wenige
der untersuchten Schädel waren durchsägt) bei Monotremen, Marsupialiern, Edentaten, Cetaceen,
Perisso- und Artiodactyliern, Sirenen, Nagetieren, Insektivoren, Carnivoren — auch bei Prosimiern.
Demgegenüber fällt sofort auf, daß der Kanal bei Primordialschädeln viel seltener au ftritt und
innerhalb einzelner Ordnungen und Familien s tark variiert. Ein allseitig vom Knorpel umschlossener
Kanal fehlt z. B. vollständig bei Echidna (G a u p p 1908), bei Diclelphys ( T o e p l i t z 1917), beim
Hunde ( O l m s t e a d 1911), bei älteren Stadien des Primordialschädels des Kaninchens (StadiumI
und I I I der V o i t s e h e n Arbeit). Auch bei TaVpa ( F i s c h e r 1901) findet sich nur eine seichte
Grube und eine Schnittserie durch einen Pferdeembryo zeigte mir, daß auch hier kein Canalis
craniopharyngeus vorhanden ist. Schon diese Verschiedenheit im Verhalten des knorpeligen und
des fertigen Schädels is t sehr auffallend. Zu irgend einer Zeit muß natürlich eine Verbindung
zwischen Rachendach und Schädelhöhle bestanden haben, aber wie kann der Kanal, der sich in der
knorpligen Schädelbasis schon geschlossen h a t , in der verknöcherten wieder von neuem
auftauchen?
Ähnliche und andere Erwägungen haben nun V o i t (1909) veranlaßt, die Homologie der
knorpelig und knöchern begrenzten Kanäle beim Kaninchen anzuzweifeln. V o i t weist die Ansicht
von A r a i (1908), daß der beim Kaninchen im knöchernen Postsphenoid stets vorhandene „Kanal“
ein Überrest des primären Hypophysengangs sei, zurück. Die ventrale Mündung des definitiven
Kanals liegt nämlich viel weiter kaudal als das bei (nur sehr jungen) Knorpelschädeln vorhandene
Hypophysenfenster. V o i t h ä lt also diese Bildung für sekundär und erldärt sie durch das Einwachsen
von venösen Blutgefäßen kurz vor und während der Verknöcherung der Basalplatte, ein
Vorgang, der in der T a t auch an anderen Stellen häufig zu beobachten ist. Selbst V o i t s jüngste
Serie zeigte schon kaudal vom Hypophysenfenster eine grubige Aushöhlung, in der sich venöse
Gefäßplexus befanden.
V o i t h a t nun meines Erachtens durchaus Recht mit seinen Ausführungen. Ich möchte noch,
darauf hinweisen, daß die Bezeichnung des Canalis craniopharyngeus für die Öffnung im Os
sphenoidale posterius des definitiven Kaninchenschädels nicht mehr angebracht erscheint, da dieser
Name implicite Beziehungen zur Entwicklung der Hypophysis andeutet, die in Wahrheit offenbar
nicht vorhanden sind.
Ehe ich nun auf die Verhältnisse eingehe, die ich bei den von mir untersuchten Megäptera-
embryonen vorfand, sei es mir gestattet, einen vergleichenden Überblick über das bisher bei Cetaceen
Festgestellte zu geben.
E s c h r i c h t (1849) sah an der knorpeligen Schädelbasis eines etwa 35 cm langen Embryo vom
Vaagewal (Balaenoptera acuto-rostrata) „in der Mitte des zum hinteren Keilbein gehörigen Anteils
eine kleine Vertiefung für den Hirnanhang . . Bei einem größeren Fetus von 6 /4 Fuß Länge
mit schon fast völlig verknöchertem Keilbein war „an der oberen Fläche die Vertiefung für den
Hirnanhang nur schwach angedeutet, vorn aber in der Mitte tiefer eingesenkt und mit einigen kleinen
Löchern versehen, worin am kleinen Fetus noch Fäden saßen, dem Anschein nach Nervenfäden“.
In beiden Fällen, die E s c h r i c h t beschreibt, ist also ein durchgehender Kanal nicht festgestellt
worden.
Der 10,5 cm lange Embryo von Balaenoptera acuto-rostrata, den de B u r l e t (1914, 1)
untersuchte, zeigte „in der oberen Fläche der Balkenplatte eine trichterförmige Einsenkung, welche
in einen den Knorpel vollständig durchbohrenden Kanal führt, Fenestra hypophyseos, Canalis
craniopharyngeus . . . Epithelreste finden sich in demselben nicht, nur einige Blutgefäße sind
vorhanden.“
Diese Befunde d e B u r l e t s können streng genommen zunächst nicht als Beweise dafür
gelten, daß hier ein echter primärer Hypophysengang vorliegt. Das Auftreten von Blutgefäßen weist
Zoologica. B e i t 69.