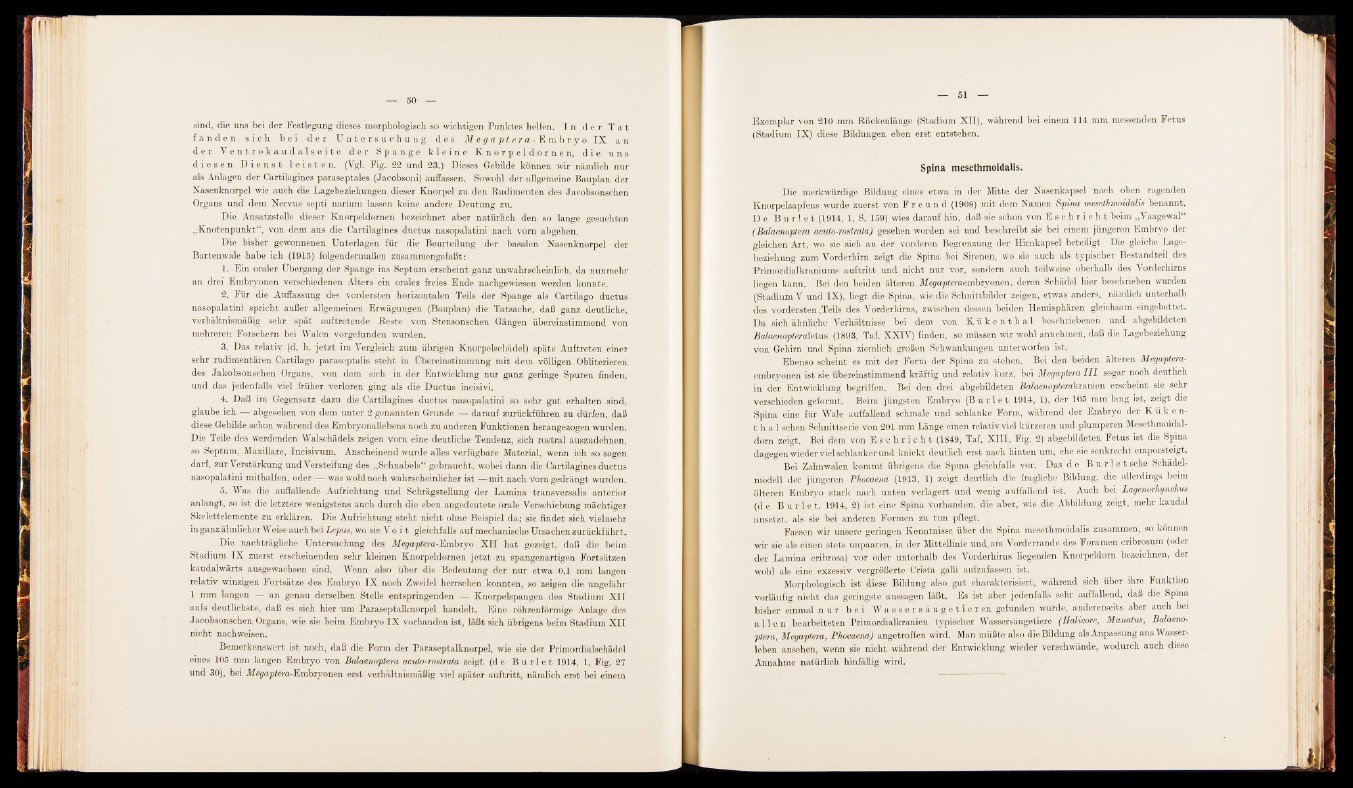
sind, die uns bei der Festlegung dieses morphologisch so wichtigen Punktes helfen. I n d e r T a t
f a n d e n s i c h b e i d e r U n t e r s u c h u u g d e s M e g a p t e r a - E m b r y o IX a n
d e r V e n t r o k a u d a l s e i t e d e r S p a n g e k l e i n e K n o r p e l d o r n e n , d i e u n s
d i e s e n D i e n s t l e i s t e n . (Vgl. Fig. 22 und 23.) Dieses Gebilde können wir nämlich nur
als Anlagen der Cartilágines paraseptales (Jacobsoni) auffassen. Sowohl der allgemeine Bauplan der
Nasenknorpel wie auch die Lagebeziehungen dieser Knorpel zu den Rudimenten des Jacobsonschen
Organs und dem Nervus septi narium lassen keine andere Deutung zu.
Die Ansatzstelle dieser Knorpeldornen bezeichnet aber natürlich den so lange gesuchten
„Knotenpunkt“ , von dem aus die Cartilágines ductus nasopalatini nach vorn abgehen.
Die bisher gewonnenen Unterlagen für die Beurteilung der basalen Nasenknorpel der
Bartenwale habe ich (1915) folgendermaßen zusammengefaßt:
1. Ein oraler Übergang der Spange ins Septum erscheint ganz unwahrscheinlich, da nunmehr
an drei Embryonen verschiedenen Alters ein orales freies Ende nachgewiesen werden konnte.
2. Für die Auffassung des vordersten horizontalen Teils der Spange als Cartílago ductus
nasopalatini spricht außer allgemeinen Erwägungen (Bauplan) die Tatsache, daß ganz deutliche,
verhältnismäßig sehr sp ät auftretende Reste von Stensonschen Gängen übereinstimmend von
mehreren Forschern bei Walen vorgefunden wurden.
3. Das relativ (d. h. je tz t im Vergleich zum übrigen Knorpelschädel) späte Auftreten einer
sehr rudimentären Cartílago paraseptalis steh t in Übereinstimmung mit dem völligen Obliterieren
des Jakobsonschen Organs, von dem sich in der Entwicklung nur ganz geringe Spuren finden,
und das jedenfalls viel früher verloren ging als die Ductus incisivi.
4. Daß im Gegensatz dazu die Cartilágines ductus nasopalatini so sehr g u t erhalten sind,
glaube ich ^ a b g e s e h e n von dem unter 2 genannten Grunde — darauf zurückführen zu dürfen, daß
diese Gebilde schon w ährend des Embryonallebens noch zu anderen Funktionen herangezogen wurden.
Die Teile des werdenden Walschädels zeigen vorn eine deutliche Tendenz, sich rostral auszudehnen,
so Septum, Maxillare, Ineisivum. Anscheinend wurde alles verfügbare Material, wenn ich so sagen
darf, zur Verstärkung und Versteifung des „Schnabels“ gebraucht, wobei dann die Cartilágines ductus
nasopalatini mithalfen, oder — was wohl noch wahrscheinlicher ist —mit n ach vorn gedrängt wurden.
5. Was die auffallende Aufrichtung und Schrägstellung der Lamina transversalis anterior
anlangt, so is t die letztere wenigstens auch durch die eben angedeutete orale Verschiebung mächtiger
Skelettelemente zu erklären. Die Aufrichtung s teht nicht ohne Beispiel d a ; sie findet sich vielmehr
in ganz ähnlicher Weise auch bei Lepus, wo sie V o i t gleichfalls auf mechanische Ursachen zurückführt.
Die nachträgliche Untersuchung des Megaptera-'&mbiyo X II h a t gezeigt, daß die beim
Stadium IX zuerst erscheinenden sehr kleinen Knorpeldornen je tz t zu spangenartigen Fortsätzen
kaudalwärts ausgewachsen sind. Wenn also über die Bedeutung der nur etwa 0,1 mm langen
relativ winzigen Fortsätze des Embryo IX noch Zweifel herrschen konnten, so zeigen die ungefähr
1 mm langen —- an genau derselben Stelle entspringenden — Knorpelspangen des Stadium X II
aufs deutlichste, daß es sich hier um Parasepfalknorpel handelt. Eine röhrenförmige Anlage des
Jacobsonschen Organs, wie sie beim Embryo IX vorhanden ist, läß t sich übrigens beim Stadium X II
nicht nachweisen.
Bemerkenswert ist noch, daß die Form der Paraseptalknorpel, wie sie der Primordialschädel
eines 105 mm langen Embryo von Balaenoptera acuto-rostrata zeigt (d e B u r l e t 1914, L, Fig. 27
und 30), bei Megaptera-Embryonen erst verhältnismäßig viel später a uftritt, nämlich erst bei einem
Exemplar von 210 mm Rückenlänge (Stadium XII), während bei einem 114 mm messenden Fetus
(Stadium IX) diese Bildungen eben erst entstehen.
Spina mesethmoidalis.
Die merkwürdige Bildung eines etwa in der Mitte der Nasenkapsel nach oben ragenden
Knorpelzapfens wurde zuersi von F r e u n d (1908) mit dem Namen Spina mesethmoidalis benannt.
D e B u r l e t (1914, 1, S. 159) wies darauf hin, daß sie schon von E s c h r i c h t beim „Vaagewal“
(Balaenoptera acuto-rostrata) gesehen worden sei und beschreibt sie bei einem jüngeren Embryo der
gleichen Art, wo sie sich an der vorderen Begrenzung der Hirnkapsel beteiligt Die gleiche Lagebeziehung
zum Vorderhirn zeigt die Spina bei Sirenen, wo sie auch als typischer Bestandteil des
Primordialkraniums au ftritt und nicht nur vor, sondern auch teilweise oberhalb des Vorderhirns
liegen kann. Bei den beiden älteren Megapteraembryonen, deren Schädel hier beschrieben wurden
(Stadium V und IX), liegt die Spina, wie die Schnittbilder zeigen, etwas anders, nämlich unterhalb
des vordersten »Teils des Vorderhirns, zwischen dessen beiden Hemisphären gleichsam eingebettet.
Da sich ähnliche Verhältnisse bei dem von K , ü k e n t h a l beschriebenen und abgebildeten
Balaenopteraiztus (1893, Taf. XXIV) finden, so müssen wir wohl annehmen, daß die Lagebeziehung
von Gehirn und Spina ziemlich großen Schwankungen unterworfen ist.
Ebenso scheint es mit der Form der Spina zu stehen. Bei den beiden älteren Megaptera-
embryonen ist sie übereinstimmend kräftig und relativ kurz, bei Megaptera I I I sogar noch deutlich
in der Entwicklung begriffen. Bei den drei abgebildeten Balaenopter$kranien erscheint sie sehr
verschieden geformt. Beim jüngsten Embryo ( B u r l e t 1914, 1), der 105 mm lang ist, zeigt die
Spina eine für Wale auffallend schmale und schlanke Form, während der Embryo der K ü k e n t
h a l sehen Schnittserie von 201 mm Länge einen relativ viel kürzeren und plumperen Mesethmoidal-
dorn zeigt. Bei dem von E s c h r i c h t (1849, Taf. X III, Fig. 2) abgebildeten Fetus ist die Spina
dagegen wieder viel schlanker und knickt deutlich erst nach hinten um, ehe sie senkrecht emporsteigt.
Bei Zahnwalen kommt übrigens die Spina gleichfalls vor. Das d e B u r i e t sehe Schädelmodell
der jüngeren Phocaena (1913, 1) zeigt deutlich die fragliche Bildung, die allerdings beim
älteren Embryo stark nach unten verlagert und wenig auffallend ist.. Auch bei Lagenorhynchus
(d e B u r l e t , 1914, 2) ist eine Spina vorhanden, die aber, wie die Abbildung zeigt, mehr kaudal
ansetzt, als sie bei anderen Formen zu tu n pflegt.
Fassen wir unsere geringen Kenntnisse über die Spina mesethmoidalis zusammen, so können
wir sie als einen stets unpaaren, in der Mittellinie und,am Vorderrande des Foramen cribrosum (oder
der Lamina cribrosa) vor oder unterhalb des Vorderhirns liegenden Knorpeldorn bezeichnen, der
wohl als eine exzessiv vergrößerte Crista galli aufzufassen ist.
Morphologisch ist diese Bildung also gut charakterisiert,, während sich über ihre Funktion
vorläufig nicht das geringste aussagen läßt. Es ist aber jedenfalls sehr auffallend, daß die Spina
bisher einmal n u r b e i W a s s e r S ä u g e t i e r en gefunden wurde, andererseits aber auch bei
a l l e n bearbeiteten Primordialkranien typischer Wassersäugetiere (Halicore, Manatus, Balaenoptera,
Megaptera, Phocaena) angetroffen wird. Man müßte also die Bildung als Anpassung ans Wasserleben
ansehen, wenn sie nicht während der Entwicklung wieder verschwände, wodurch auch diese
Annahme natürlich hinfällig wird.