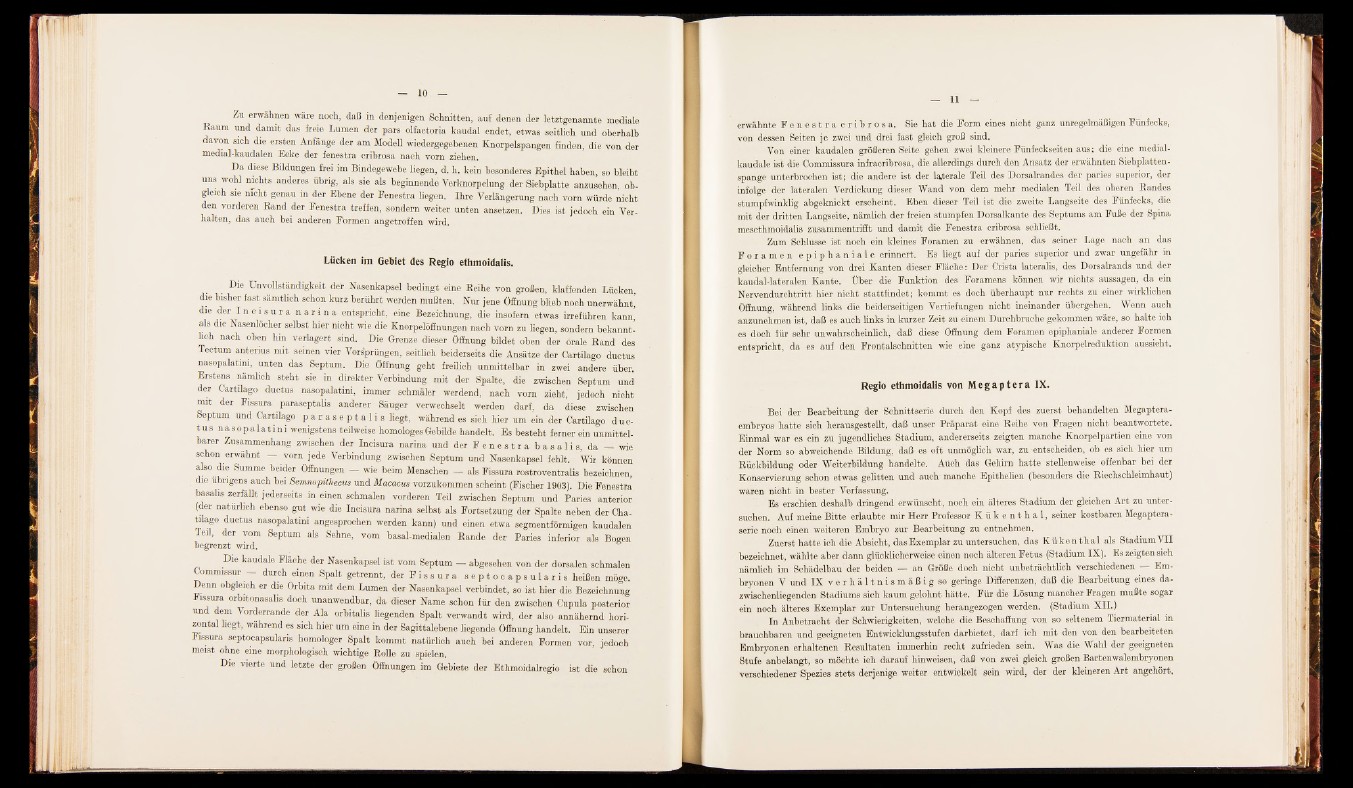
Zu erwähnen wäre noch, daß in denjenigen Schnitten, auf denen der letztgenannte mediale
Raum und damit das freie Lumen der pars olfactoria kaudal endet, etwas seitlich und oberhalb
davon sich die ersten Anfänge der am Modell wiedergegebenen Knorpelspangen finden, die von der
medial-kaudalen Ecke der fenestra cribrosa nach vom ziehen.
Da diese Bildungen frei im Bindegewebe liegen, d. h. kein besonderes Epithel haben, so bleibt
uns wohl nichts anderes übrig, als sie als beginnende Verknorpelung der Siebplatte anzusehen obgleich
sie nicht genau in der Ebene der Fenestra Hegen. Ihre Verlängerung nach vorn würde nicht
den vorderen Rand der Fenestra treffen, sondern weiter unten ansetzen. Dies ist jedoch ein Verhalten,
das auch bei anderen Formen angetroffen wird.
Lücken im Gebiet des Regio ethmoidalis.
Die Unvollständigkeit der Nasenkapsel bedingt eine Reihe von großen, klaffenden Lücken,
die bisher fast sämthch schon kurz berührt werden mußten. Nur jene Öffnung hheh noch unerwähnt’
die der I n c i s u r a n a r i n a entspricht, eine Bezeichnung, die insofern etwas irreführen kann,
als die Nasenlöcher seihst hier nicht wie die Knorpelöffnungen nach vom zu Hegen, sondern bekannt-
Hch nach oben hin verlagert sind. Die Grenze dieser Öffnung bildet oben der orale Rand des
Tectum antenus mit seinen vier Vorsprüngen, seitHch beiderseits die Ansätze der Cartilago ductüs
nasopalatini, unten das Septum. Die Öffnung geht freiHch unmittelbar in zwei andere über.
Erstens namHch steh t sie m direkter Verbindung mit der Spalte, die zwischen Septum und
der Cartilago ductus nasopalatini, immer schmäler werdend, nach vorn zieht,’ jedoch nicht
mit der Fissura paraseptaHs anderer Säuger verwechselt werden darf, da ..diese zwischen
Septum und Cartilago p a r a s e p t a l i s Hegt, während es sich hier um ein der Cartilago duc-
t u s n a s o p a l a t i n i wenigstens teilweise homologes Gebilde handelt. Es besteht ferner ein unmittelbarer
Zusammenhang zwischen der Incisura narina und der F e n e s t r a b a s a 1 i s |§ |i f } § wie
schon erwähnt — vom jede Verbindung zwischen Septum und Nasenkapsel fehlt. Wir können
also die Summe beider Öffnungen — wie beim Menschen j | als Fissura rostroventraHs bezeichnen,
die übrigens auch bei Semnopithaeus und Macacus vorzukommen scheint (Fischer 1903). Die Fenestra
basaHs zerfällt jederseits in einen schmalen vorderen Teil zwischen Septum und Paries anterior
(der naturhch ebenso gut wie die Incisura narina selbst als Fortsetzung der Spalte neben der Cha-
falago ductus nasopalatini angesprochen werden kann) und einen etwa segmentförmigen kaudalen
Teil, der vom Septum als Sehne, vom basal-medialen Rande der Paries inferior als Bogen
begrenzt wird.
Die kaudale Fläche der Nasenkapsel ist vom Septum — abgesehen von der dorsalen schmalen
Commissur B durch einen Spalt getrennt, der F i s s u r a s e p t o c a p s u 1 a r i s heißen möge.
Denn obgleich er die Orbita mit dem Lumen der Nasenkapsel verbindet, so ist hier die Bezeichnung
Fissura orbitonasalis doch unanwendbar, da dieser Name schon für den zwischen Cupula posterior
und dem Vorderrande der Ala orbitahs Hegenden Spalt verwandt wird, der also annähernd horizontal
Hegt, während es sich hier um eine in der Sagittalebene Hegende Öffnung handelt. Ein unserer
Fissura septooapsulans homologer Spalt kommt natürlich auch bei anderen Formen vor, jedoch
meist ohne eine morphologisch wichtige RoUe zu spielen.
Die vierte und letzte der großen Öffnungen im Gebiete der Ethmoidalregio ist die schon
erwähnte F e n i f t r a c f i h r o s a. Sie h a t die Form eines nicht ganz unregelmäßigen Fünfecks,
von dessen Seiten je zwei und drei fast gleich groß sind.
Von einer kaudälei- größeren :Sgiie gehen zwei kleinefe Fünfeckseiten aus; die eine medialkaudale
ist die-Commissura infracribrosa, die allerdings durch den Ansatz der erwähnten Siebplattenspange
unterbrochen ist; die andere ist der laterale Teil des Dorsalrandes der paries superior, der
infolge der lateralen Verdickung dieser Wand von dem mehr medialen Teil des oberen Randes
stumpfwinkHg abgeknickt erscheint. Ehen dieser Teil ist die zweite Langseite, des Fünfecks, die
mit der dritten Langseite, nämhch der freien stumpfen Dorsalkante des Septums am Füße der Spina
mesethmoidahs zusammentrifft und damit die Fenestra cribrosa schHeßt.
Zum Schlüsse is t noch ein kleines Foramen zu erwähnen, das- seiner Lage nach an das
F o r a m e n e p i p h a n i a l e erinnert. Es Hegt auf der paries' superior und zwar .ungefähr -in
gleioher Entfernung von drei Kanten dieser Fläche: Der Crista laterahs, des Dorsalrands und der
kaudal-lateralen Kante; Über die Funktion des Foramens können wir nichts. Aussagen, da ein
NeTvendurchtritt hier nicht s tattfinde t; kommt es doch überhaupt nur rechts zu einer wirklichen
Öffnung, während links die beiderseitigen Vertiefungen nicht ineinander übergehen. Wenn auch
anzunehmen ist, daß es auch Hnks in kurzer Zeit zu einem D urchbruche gekommen wäre, so halte ich
es doch für sehr unwahrscheinlich, daß diese Öffnung dem Foramen epiphaniale anderer Formen
entspricht, da es auf den Frontalschnitten wie eine ganz atypische Knorpelreduktion aussieht.
Regio ethmoidalis von Me g a p t e r a IX.
Bei der Bearbeitung der Schnittserie durch den Kopf des zuerst behandelten Megaptera-
embryos h a tte sich herausgestellt, daß unser Präp a ra t eine Reihe von Fragen nicht beantwortete.
Einmal war es -hin zu jugencUiches Stadium, andererseits zeigten manche Knorpelpartien eine von
der Norm so abweichende Bildung, daß1 ¡S oft unmöglich war, zu-entscheiden, ob sich -Ker um
Rückbildung oder Weiterbildung handelte. Auch das Gehirn h a tte stellenweise offenbar bei der
Konservierung schon etwas gelitten und auch'manche EpitheHen (besonders die Riechschleimhaut)
waren nicht in bester Verfassung.
Es erschien deshalb dringend erwünscht, noch ein älteres Stadium der gleichen Art zu unter-
suchen. Auf meine B itte erlaubte mir Herr Professor K ü k e n t h a l , seiner kostbaren Megaptera-
serie noch einen weiteren Embryo zur Bearbeitung zu entnehmen.
Zuerst h a tte ich die Absicht, das Exemplar zu untersuchen, das K ü k e n t h a l als Stadium VII
bezeichnet, wählte aber dann glücklicherweise einen noch älteren Fetus (Stadium IX). Es zeigten sich
nämHch im Schädelbau der beiden — an Größe doch nicht unbeträchtHch verschiedenen — Embryonen
V und IX v e r h ä l t n i s m ä ß i g so geringe Differenzen, daß die Bearbeitung eines da-
zwischenHegenden Stadiums sich kaum gelohnt hätte. Fü r die Lösung mancher Fragen mußte sogar
ein noch älteres Exemplar zur Untersuchung herangezogen werden. (Stadium XII.)
In Anbetracht der Schwierigkeiten, welche die Beschaffung von so seltenem Tiermaterial in
brauchbaren und geeigneten Entwicklungsstufen darbietet, darf ich mit den von den bearbeiteten-
Embryonen erhaltenen Resultaten immerhin recht zufrieden sein. Was die Wahl der geeigneten
Stufe anbelangt, so möchte ich darauf hinweisen, daß von zwei gleich großen Bartenwalembryonen
verschiedener Spezies stets derjenige weiter entwickelt sein wird, der der kleineren Art angehört.