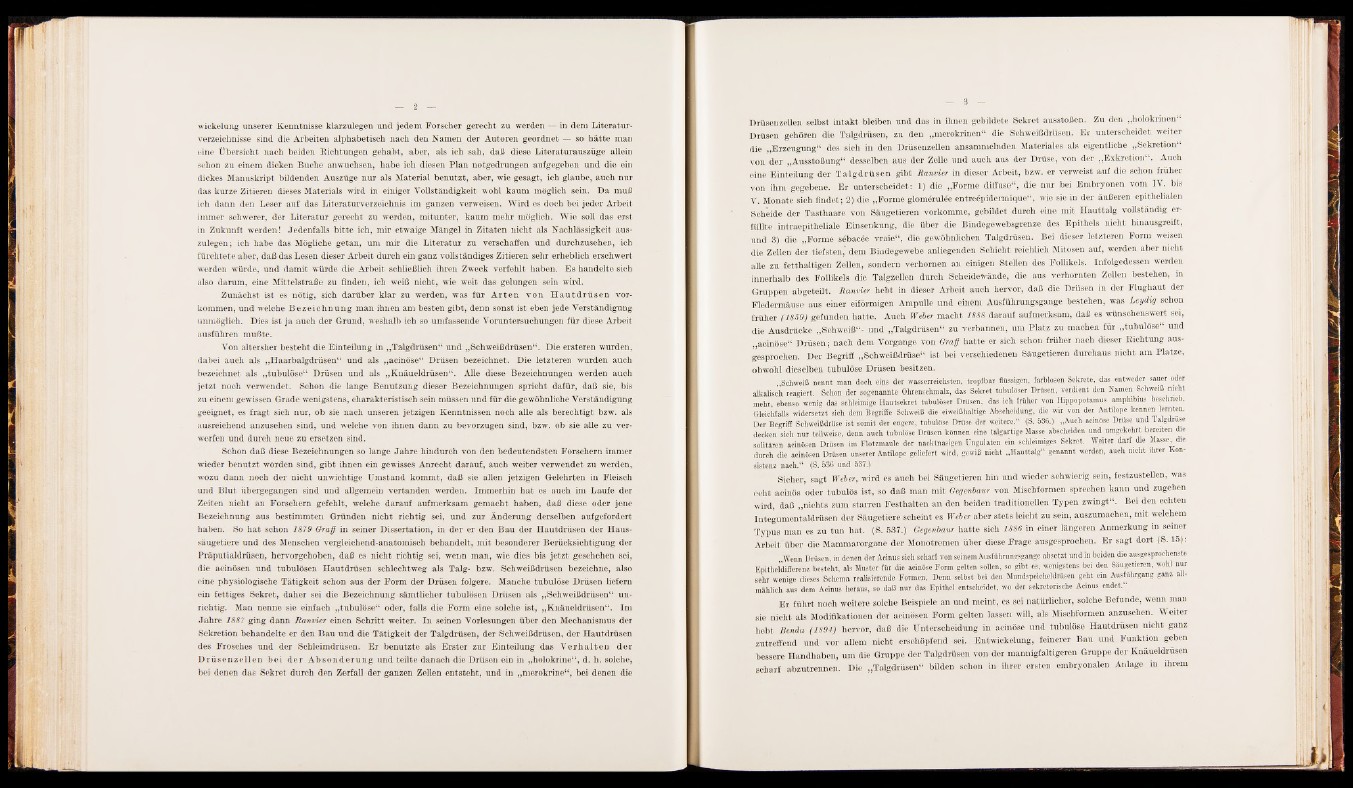
Wickelung unserer Kenntnisse klarzulegen und jedem Forscher gerecht zu werden — in dem Literaturverzeichnisse
sind die Arbeiten alphabetisch nach den Namen der Autoren geordnet f ||s o hätte man
eine Übersicht nach beiden Richtungen gehabt, aber, als ich sah, daß diese Literaturauszüge allein
schon zu einem dicken Buche anwuchsen, habe ich diesen Plan notgedrungen aufgegeben und die ein
dickes Manuskript bildenden Auszüge nur als Material benutzt, aber, wie gesagt, ich glaube, auch nur
das kurze Zitieren dieses Materials wird in einiger Vollständigkeit wohl kaum möglich sein. Da muß
ich dann den Leser auf das Literaturverzeichnis im ganzen verweisen. Wird es doch bei jeder Arbeit
immer schwerer, der Literatur gerecht zu werden, mitunter, kaum mehr möglich. Wie soll das erst
in Zukunft werden! Jedenfalls bitte ich, mir etwaige Mängel in Zitaten nicht als Nachlässigkeit auszulegen;
ich habe das Mögliche getan, um mir die Literatur zu verschaffen und durchzusehen, ich
fürchtete aber, daß das Lesen dieser Arbeit durch ein ganz vollständiges Zitieren sehr erheblich erschwert
werden würde, und damit würde die Arbeit schließlich ihren Zweck verfehlt haben. Es handelte sich
also darum, eine Mittelstraße zu finden, ich weiß nicht, wie weit das gelungen sein wird.
Zunächst ist es nötig, sich darüber klar zu werden, was für Arten von H au td rü sen Vorkommen,
und welche B ez e ich n u n g man ihnen am besten gibt, denn sonst ist eben jede Verständigung
unmöglich. Dies ist ja auch der Grund, weshalb ich so umfassende Voruntersuchungen für diese Arbeit
ausführen mußte.
Von altersher besteht die Einteilung in „Talgdrüsen“ und „Schweißdrüsen“. Die ersteren wurden,
dabei auch als „Haarbalgdrüsen“ und als „acinösc“ Drüsen bezeichnet. Die letzteren wurden auch
bezeichnet als „tubulöse“ Drüsen und als „Knäueldrüsen“. Alle diese Bezeichnungen werden auch
jetzt noch verwendet. Schon die lange Benutzung dieser Bezeichnungen spricht dafür, daß sie, bis
zu einem gewissen Grade wenigstens, charakteristisch sein müssen und für die gewöhnliche Verständigung
geeignet, es fragt sich nur, ob sie nach unseren jetzigen Kenntnissen noch alle als berechtigt bzw. als
ausreichend anzusehen sind, und welche von ihnen dann zu bevorzugen sind, bzw. ob sie alle zu verwerfen
und durch neue zu ersetzen sind.
Schon daß diese Bezeichnungen so lange Jahre hindurch von den bedeutendsten Forschern immer
wieder benutzt worden sind, gibt ihnen ein gewisses Anrecht darauf, auch weiter verwendet zu werden,
wozu dann noch der nicht unwichtige Umstand kommt, daß sie allen jetzigen Gelehrten in Fleisch
und Blut übergegangen sind und allgemein vertanden werden. Immerhin hat es auch im Laufe der
Zeiten nicht an Forschern gefehlt, welche darauf aufmerksam gemacht haben, daß diese oder jene
Bezeichnung aus bestimmten Gründen nicht richtig sei, und zur Änderung derselben aufgefordert
haben. So hat schon 1879 Graff in seiner Dissertation, in der er den Bau der Hautdrüsen der Haussäugetiere
und des Menschen vergleichend-anatomisch behandelt, mit besonderer Berücksichtigung der
Präputialdrüsen, hervorgehoben, daß es nicht richtig sei, wenn man, wie dies bis jetzt geschehen sei,
die acinösen und tubulösen Hautdrüsen schlechtweg als Talg- bzw. Schweißdrüsen bezeichne, also
eine physiologische Tätigkeit schon aus der Form der Drüsen folgere. Manche tubulöse Drüsen liefern
ein fettiges Sekret, daher sei die Bezeichnung sämtlicher tubulösen Drüsen als „Schweißdrüsen“ unrichtig.
Man nenne sie einfach „tubulöse“ oder, falls die Form eine solche ist, „Knäueldrüsen“. Im
Jahre 1887 ging dann Ranvier einen Schritt weiter. In seinen Vorlesungen über den Mechanismus der
Sekretion behandelte er den Bau und die Tätigkeit der Talgdrüsen, der Schweißdrüsen, der Hautdrüsen
des Frosches und der Schleimdrüsen. Er benutzte als Erster zur Einteilung das Verh alten der
D rü sen z e llen bei der Absonderung und teilte danach die Drüsen ein in „holokrine“, d. h. solche,
bei denen das Sekret durch den Zerfall der ganzen Zellen entsteht, und in „merokrine“, bei denen die
Drüsenzellen selbst intakt bleiben und das in ihnen gebildete Sekret ausstoßen. Zu den „holokrinen“
Drüsen gehören die Talgdrüsen, zu den „merokrinen“ die Schweißdrüsen. Er unterscheidet, weiter
die „Erzeugung“ des sich in den Drüsenzellen ansammelnden Materiales als eigentliche „Sekretion“
von der „Ausstoßung“ desselben aus der Zelle und auch aus der Drüse, von der „Exkretion . Auch
eine Einteilung der Talgdrüsen gibt Ranvier in dieser Arbeit, bzw. er verweist auf die schon früher
von ihm gegebene. Er unterscheidet: 1) die „Forme diffuse“, die nur bei Embryonen vom IV. bis
V. Monate sich findet; 2) die „Forme glomérulée entreépidermique“, wie sie in der äußeren epithelialen
Scheide der Tasthaare von Säugetieren vorkomme, gebildet durch eine mit Hauttalg vollständig erfüllte
intraepitheliale Einsenkung, die über die Bindegewebsgrenze des Epithels nicht hinausgreift,
und 3) die „Forme sébacée vraie“, die gewöhnlichen Talgdrüsen. Bei dieser letzteren Form weisen
die Zellen der tiefsten, dem Bindegewebe anliegenden Schicht reichlich Mitosen auf, werden aber nicht
alle zu fetthaltigen Zellen, sondern verhornen an einigen Stellen des Follikels. Infolgedessen werden
innerhalb des Follikels die Talgzellen durch Scheidewände, die aus verhornten Zellen bestehen, in
Gruppen abgeteilt. Ranvier hebt in dieser Arbeit auch hervor, daß die Drüsen in der Flughaut der
Fledermäuse aus einer eiförmigen Ampulle und einem Ausführungsgange bestehen, was Leydig schon
früher (1859) gefunden hatte. Auch Weber macht 1888 darauf aufmerksam, daß es wünschenswert sei,
die Ausdrücke „Schweiß“- und „Talgdrüsen“ zu verbannen, um Platz zu machen für „tubulöse“ und
„acinöse“ Drüsen; nach dem Vorgänge von Graff hatte er sich schon früher nach dieser Richtung ausgesprochen.
Der Begriff „Schweißdrüse“ ist bei verschiedenen Säugetieren durchaus nicht am Platze,
obwohl dieselben tubulöse Drüsen besitzen.
„Schweiß nennt man doch eins der wasserreichsten, tropfbar flüssigen, farblosen Sekrete, das entweder sauer oder
alkalisch reagiert. Schon der sogenannte Ohrenschmalz, das Sekret tubulöser Drüsen, verdient den Namen Schweiß nicht
mehr, ebenso wenig das schleimige Hautsekret tubulöser Drüsen, das ich früher von Hippopotamus amphibius beschrieb.
Gleichfalls widersetzt sich dem Begriffe Schweiß die eiweißhaltige Abscheidung, die wir von der Antilope kennen lernten.
Der Begriff Schweißdrüse ist somit der engere, tubulöse Drüse der weitere.“ (S. 536.) „Auch acinöse Drüse und Talgdrüse
decken sich nur teilweise, denn auch tubulöse Drüsen können eine talgartige Masse abscheiden und umgekehrt bereiten die
solitären acinösen Drüsen im Flotzmaule der nacktnasigen Ungulaten ein schleimiges Sekret. Weiter darf die Masse, die
durch die acinösen Drüsen unserer Antilope geliefert wird, gewiß nicht „Hauttalg“ genannt werden, auch nicht ihrer Konsistenz
nach.“ (S. 536 und 537.)
Sieber, sagt Weber, wird es auch bei Säugetieren hin und wieder schwierig sein, festzustellen, was
echt acinös oder tubulös ist, so daß man mit Gegenbaur von Mischformen sprechen kann und zugeben
wird, daß „nichts zum starren Festhalten an den beiden traditionellen Typen zwingt“. Bei den echten
Integumentaldrüsen der Säugetiere scheint es Weber aber stets leicht zu sein, auszumachen, mit welchem
Typus man es zu tun hat. (S. 537.) Gegenbaur hatte sich 1886 in einer längeren Anmerkung in seiner
Arbeit'über die Mammarorgane der Monotremen über diese Frage ausgesprochen. Er sagt dort (S. 15):
„Wenn Drüsen, in denen der Acinus sich scharf von seinem Ausführungsgange absetzt und in beiden die ausgesprochenste
Epitheidifferenz besteht, als Muster für die acinöse Form gelten sollen, so gibt es, wenigstens bei den Säugetieren, wohl nur
sehr wenige dieses Schema realisierende Formen. Denn selbst bei den Mundspeicheldrüsen geht ein Ausführgang ganz al -
mählich aus dem Acinus heraus, so daß nur das Epithel entscheidet, wo der sekretorische Acinus endet.“
Er führt noch weitere solche Beispiele an und meint, es sei natürlicher, solche Befunde, wenn man
sie nicht als Modifikationen der acinösen Form gelten lassen will, als Mischformen anzusehen. Weiter
hebt Benda (1894) hervor, daß die Unterscheidung in acinöse und tubulöse Hautdrüsen nicht ganz
zutreffend und vor allem nicht erschöpfend sei. Entwickelung, feinerer Bau und Funktion geben
bessere Handhaben, um die Gruppe der Talgdrüsen von der mannigfaltigeren Gruppe der Knäueldrusen
scharf abzutrennen. Die „Talgdrüsen“ bilden schon in ihrer ersten embryonalen Anlage in ihrem