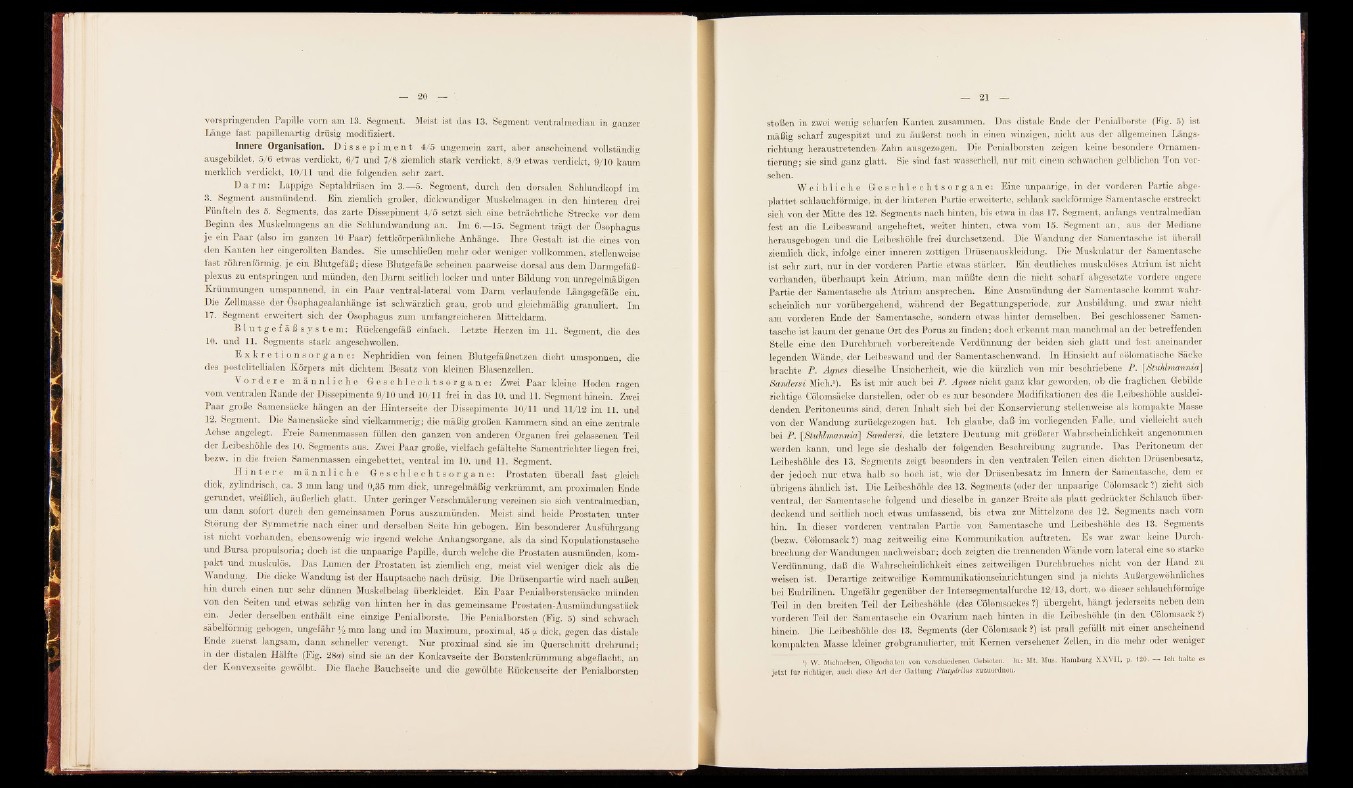
vorspringenden Papille vom am 13. Segment. Meist ist das 13. Segment ventralmedian in ganzer
Länge fast papillenartig drüsig modifiziert.
Innere Organisation. D i s s e p i m e n t 4/5 ungemein zart, aber anscheinend vollständig
ausgebildet, 5/6 etwas verdickt, 6/7 und 7/8 ziemlich stark verdickt, 8/9 etwas verdickt, 9/10 kaum
merklich verdickt, 10/11 und die folgenden sehr zart.
D a r m : Lappige Septaldrüsen im 3 . - 5 . Segment, durch den dorsalen Schlundkopf im
3. Segment ausmündend. Ein ziemlich großer, dickwandiger Muskelmagen in den hinteren drei
Fünfteln des 5. Segments, das zarte Dissepiment 4/5 setzt sich eine beträchtliche Strecke vor dem
Beginn des Muskelmagens an die Schlundwandung an. Im 6.—15. Segment trä g t der Ösophagus
je ein Pa a r (also im ganzen 10 Paar) fettkörperähnliche Anhänge. Ihre Gestalt ist die eines von
den Kanten her eingerollten Bandes. Sie umschließen mehr oder weniger vollkommen, stellenweise
fast röhrenförmig, je ein Blutgefäß; diese Blutgefäße scheinen paarweise dorsal aus dem Darmgefäßplexus
zu entspringen und münden, den D arm seitlich locker und unter Bildung von unregelmäßigen
Krümmungen umspannend, in ein Paar ventral-lateral vom Darm verlaufende Längsgefäße ein.
Die Zellmasse der ösophagealanhänge ist schwärzlich grau, grob und gleichmäßig granuliert. Im
17. Segment erweitert sich der Ösophagus zum umfangreicheren Mitteldarm.
B l u t g e f ä ß s y s t e m : Rückengefäß einfach. Letzte Herzen im 11. Segment, die des
10. und 11. Segments stark angeschwollen.
E x k r e t i o n s o r g a n e : Nephridien von feinen Blutgefäßnetzen dicht umsponnen, die
des postclitelliälen Körpers mit dichtem Besatz von kleinen Blasenzellen.
V o r d e r e m ä n n l i c h e G e s c h l e c h t s o r g a n e : Zwei Paar kleine Hoden ragen
vom ventralen Rande der Dissepimente 9/10 und 10/11 frei in das 10. und 11. Segment hinein. Zwei
Paar große Samensäcke hängen an der Hinterseite der Dissepimente 10/11 und 11/12 im 11. und
12. Segment. Die Samensäcke sind vielkammerig; die mäßig großen Kammern sind an eine zentrale
Achse angelegt. Freie Samenmassen füllen den ganzen von anderen Organen frei gelassenen Teil
der Leibeshöhle des 10. Segments aus. Zwei Paar große, vielfach gefältelte Samentrichter liegen frei,
bezw. in die freien Samenmassen eingebettet, ventral im 10. und 11. Segment.
H i n t e r e m ä n n l i c h e G e s c h l e c h t s o r g a n e : Prostaten überall fast gleich
dick, zylindrisch, ca. 3 mm lang und 0,35 mm dick, unregelmäßig verkrümmt, am proximalen Ende
gerundet, weißlich, äußerlich glatt. Unter geringer Verschmälerung vereinen sie sich ventralmedian,
um dann sofort durch den gemeinsamen Porus auszumünden. Meist sind beide Prostaten unter
Störung der Symmetrie nach einer und derselben Seite hin gebogen. Ein besonderer Ausführgang
ist nicht vorhanden, ebensowenig wie irgend welche Anhangsorgane, als da sind Kopulationstasche
und Bursa propulsoria; doch ist die unpaarige Papille, durch welche die Prostaten ausmünden, kompakt
und muskulös. Das Lumen der Prostaten ist ziemlich eng, meist viel weniger dick als die
Wandung. Die dicke Wandung ist der Hauptsache nach drüsig. Die Drüsenpartie wird nach außen
hin durch einen nur sehr dünnen Muskelbelag überkleidet. Ein Paar Penialborstensäcke münden
von den Seiten und etwas schräg von hinten her in das gemeinsame Prostaten-Ausmündungsstück
ein. Jeder derselben enthält eine einzige Penialborste. Die Penialborsten (Fig. 5) sind schwach
säbelförmig gebogen, ungefähr % mm lang und im Maximum, proximal, 45 p. dick, gegen das distale
Ende zuerst langsam, dann schneller verengt. Nur proximal sind sie im Querschnitt drehrund;
in der distalen Hälfte (Fig. 28a) sind sie an der Konkavseite der Borstenkrümmung abgeflacht, an
der Konvexseite gewölbt. Die flache Bauchseite und die gewölbte Rückenseite der Penialborsten
stoßen in zwei wenig scharfen Kanten zusammen. Das distale Ende der Penialborste (Fig. 5) ist
mäßig scharf zugespitzt und zu äußerst noch in einen winzigen, nicht aus der allgemeinen Längsrichtung
heraustretenden Zahn ausgezogen. Die Penialborsten zeigen keine besondere Omamen-
tierung; sie sind ganz glatt. Sie sind fast wasserhell, nur mit einem schwachen gelblichen Ton versehen.
W e i b l i c h e G e s c h l e c h t s o r g a n e : Eine unpaarige, in der vorderen Partie abgep
la tte t schlauchförmige, in der hinteren Partie erweiterte, schlank sackförmige Samentasche erstreckt
sich von der Mitte des 12. Segments nach hinten, bis etwa in das 17. Segment, anfangs ventralmedian
fest an die Leibeswand angeheftet, weiter hinten, etwa vom 15. Segment a n , aus der Mediane
herausgebogen und die Leibeshöhle frei durchsetzend. Die Wandung der Samentasche ist überall
ziemlich dick, infolge einer inneren zottigen Drüsenauskleidung. Die Muskulatur der Samentasche
ist sehr zart, nur in der vorderen Partie etwas stärker. Ein deutliches muskulöses Atrium ist nicht
vorhanden, überhaupt kein Atrium, man müßte denn die nicht scharf abgesetzte vordere engere
Partie der Samentasche als Atrium ansprechen. Eine Ausmündung der Samentasche kommt wahrscheinlich
nur vorübergehend, während der Begattungsperiode, zur Ausbildung, und zwar nicht
am vorderen Ende der Samentasche, sondern etwas hinter demselben. Bei geschlossener Samentasche
ist kaum der genaue Ort des Porus zu finden; doch erkennt m an manchmal an der betreffenden
Stelle eine den Durchbruch vorbereitende Verdünnung der beiden sich glatt und fest aneinander
legenden Wände, der Leibeswand und der Samentaschenwand. In Hinsicht auf cölomatische Säcke
brachte P. Agnes dieselbe Unsicherheit, wie die kürzlich von mir beschriebene P. [StuUmannid]
Sandersi Mich.1). Es ist mir auch bei P. Agnes nicht ganz klar geworden, ob die fraglichen Gebilde
richtige Cölomsäcke darstellen, oder ob es nur besondere Modifikationen des die Leibeshöhle auskleidenden
Peritoneums sind, deren Inha lt sich bei der Konservierung stellenweise als kompakte Masse
von der Wandung zurückgezogen hat. Ich glaube, daß im vorliegenden Falle, und vielleicht auch
bei P. [Stuhlmannid] Sandersi, die letztere Deutung mit größerer Wahrscheinlichkeit angenommen
werden kfl.nn; und lege sie deshalb der folgenden Beschreibung zugrunde. Das Peritoneum der
Leibeshöhle des 13. Segments zeigt besonders in den ventralen Teilen einen dichten Drüsenbesatz,
der jedoch nur etwa halb so hoch ist, wie der Drüsenbesatz im Innern der Samentasche, dem er
übrigens ähnlich ist. Die Leibeshöhle des 13. Segments (oder der unpaarige Cölomsack ?) zieht sich
ventral, der Samentasche folgend und dieselbe in ganzer Breite als p la tt gedrückter Schlauch überdeckend
und seitlich noch etwas umfassend, bis etwa zur Mittelzone des 12. Segments nach vorn
hin. In dieser vorderen ventralen Partie von Samentasche und Leibeshöhle des 13. Segments
(bezw. Cölomsack?) mag zeitweilig eine Kommunikation auftreten. Es war zwar keine Durchbrechung
der W andungen nachweisbar; doch zeigten die trennenden Wände vorn lateral eine so starke
Verdünnung, daß die Wahrscheinlichkeit eines zeitweiligen Durchbruches nicht von der Hand zu
weisen ist. Derartige zeitweilige Kommunikationseinrichtungen sind ja nichts Außergewöhnliches
bei Eudrilinen. Ungefähr gegenüber der Intersegmentalfurche 12/13, dort, wo dieser schlauchförmige
Teil in den breiten Teil der Leibeshöhle (des Cölomsackes ?) übergeht, hängt jederseits neben dem
vorderen Teil der Samentasche ein Ovarium nach hinten in die Leibeshöhle (in den Cölomsack ?)
hinein. Die Leibeshöhle des 13. Segments (der Cölomsack ?) ist prall gefüllt mit einer anscheinend
kompakten Masse kleiner grobgranulierter, mit Kernen versehener Zellen, in die mehr oder weniger
i) \y. Michaelsen, Oligochäten von verschiedenen Gebieten. In: Mt. Mus. Hamburg XXVII, p= 120. Ich halte es
• jetzt für richtiger, auch diese Art der Gattung Platydrilus zuzuordnen.