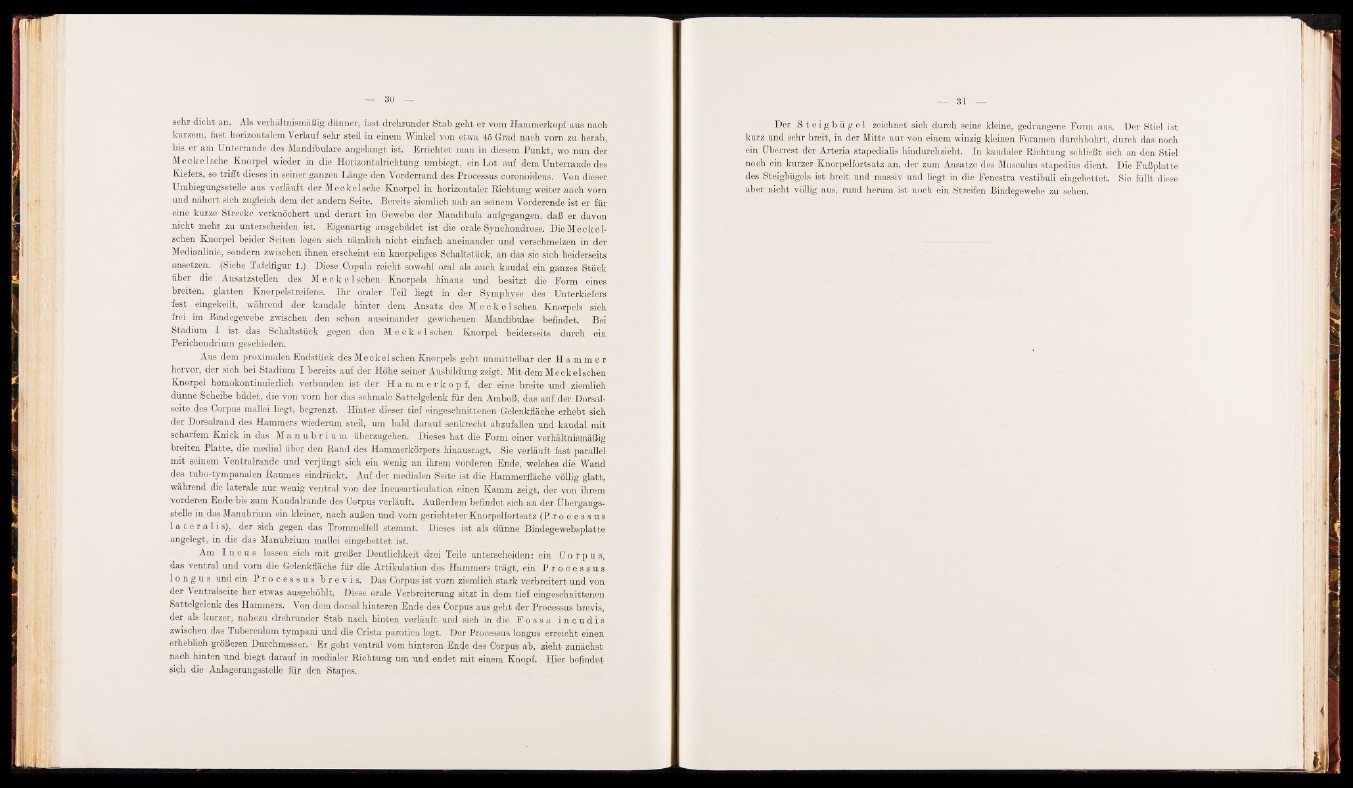
selir dicht an. Als verhältnismäßig dünner, fast drehrunder Stab geht er vom Hammerkopf aus nach
kurzem, fast horizontalem Verlauf sehr steil in einem Winkel von etwa 45 Grad nach vorn zu herab,
bis er am Unterrande des Mandibulare angelangt ist. Errichtet man in diesem Punkt, wo nun der
Me ekel sehe Knorpel wieder in die Horizontalrichtung umbiegt, ein Lot auf dem Unterrande des
Kiefers, so trifft dieses in seiner ganzen Länge den Vorderrand des Processus coronoideus. Von dieser
Umbiegungsstelle aus verläuft der Me e k e l sehe Knorpel in horizontaler Richtung weiter nach vorn
und nähert sich zugleich dem der ändern Seite. Bereits ziemlich nah an seinem Vorderende ist er für
eine kurze Strecke verknöchert und derart im Gewebe der Mandibula aufgegangen, daß er davon
nicht mehr zu unterscheiden ist. Eigenartig ausgebildet ist die orale Synchondrose. Die M e c k e l-
schen Knorpel beider Seiten legen sich nämlich nicht einfach aneinander und verschmelzen in der
Medianlinie, sondern zwischen ihnen erscheint ein knorpeliges Schaltstück, an das sie sich beiderseits
ansetzen. (Siehe Tafelfigur 1.) Diese Copula reicht sowohl oral als auch kaudal ein ganzes Stück
über die Ansatzstellen des M e c k e l sehen Knorpels hinaus und besitzt die Form eines
breiten, glatten Knorpelstreifens. Ih r oraler Teil liegt in der Symphyse des Unterkiefers
fest eingekeilt, während der kaudale hinter dem Ansatz des M e c k e l sehen Knorpels sich
frei im Bindegewebe zwischen den schon auseinander gewichenen Mandibulae befindet. Bei
Stadium I ist das Schaltstück gegen den M e c k e l sehen Knorpel beiderseits durch ein
Perichondrium geschieden.
Aus dem proximalen Endstück des Me ekel sehen Knorpels geht unmittelbar der H a m m e r
hervor, der sich bei Stadium I bereits auf der Höhe seiner Ausbildung zeigt. Mit dem Meckelschen
Knorpel homokontinuierlich verbunden ist der H a m m e r k o p f , der eine breite -und ziemlich
dünne Scheibe bildet, die von vom her das schmale Sattelgelenk für den Amboß, das auf der Dorsalseite
des Corpus mallei liegt, begrenzt. Hinter dieser tief eingeschnittenen Gelenkfläche erhebt sich
der Dorsalrand des Hammers wiederum steil, um bald darauf senkrecht abzufallen und kaudal mit
scharfem Knick in das M a n u b r i u m überzugehen. Dieses hat die Form einer verhältnismäßig
breiten Platte, die medial über den Rand des Hammerkörpers hinausragt. Sie verläuft fast parallel
mit seinem Ventralrande und verjüngt sich ein wenig an ihrem vorderen Ende, welches die Wand
des tubo-tympanalen Raumes eindrückt. Auf der medialen Seite ist die. Hammerfläche völlig glatt,
während die laterale nur wenig ventral von der Incusarticulation einen Kamm zeigt, der von ihrem
vorderen Ende bis zum Kaudalrande des Corpus verläuft. Außerdem befindet sich an der Übergangsstelle
in das Manubrium ein kleiner, nach außen und vorn gerichteter Knorpelfortsatz ( P r o c e s s u s
l a t e r a l i s ) , der sich gegen das Trommelfell stemmt. Dieses ist als dünne Bindege websplatte
angelegt, in die das Manubrium mallei eingebettet ist.
Am I n c u s lassen sich mit großer Deutlichkeit drei Teile unterscheiden: ein C o r p u s ,
das ventral und vorn die Gelenkfläche für die Artikulation des Hammers träg t, ein P r o c e s s u s
1 o n g u s und ein P r o c e s s u s b r e v i s . Das Corpus ist vorn ziemlich s tark verbreitert und von
der Ventralseite her etwas ausgehöhlt. Diese orale Verbreiterung sitzt in dem tief eingeschnittenen
Sattelgelenk des Hammers. Von dem dorsal hinteren Ende des Corpus aus geht der Processus brevis,
der als kurzer, nahezu drehrunder Stab nach hinten verläuft und sich in die F o s s a i n c u d i s
zwischen das Tuberculum tympani und die Crista parotica legt. Der Processus longus erreicht einen
erheblich-größeren Durchmesser. - Er geht ventral vom h interen Ende des Corpuä ab,- zieht zunächst
nach hinten und biegt darauf in medialer Richtung um und endet mit einem Knopf. Hier befindet
sich die Anlagerungsstelle für. den Stapes,
Der S t e i g b ü g e l zeichnet sich durch seine kleine, gedrungene Form aus. Der Stiel ist
kurz und sehr breit, in der Mitte nur von einem winzig kleinen Foramen durchbohrt, durch das noch
ein Überrest der Arteria stapedialis hindurchzieht. In kaudaler Richtung schließt sich an den Stiel
noch ein kurzer Knorpelfortsatz an, der zum Ansätze des Musculus stapedius dient. Die Fußplatte
des Steigbügels ist breit und massiv und liegt in die Fenestra vestibuli eingebettet. Sie füllt diese
aber nicht völlig aus, rund herum ist noch ein Streifen Bindegewebe zu sehen.