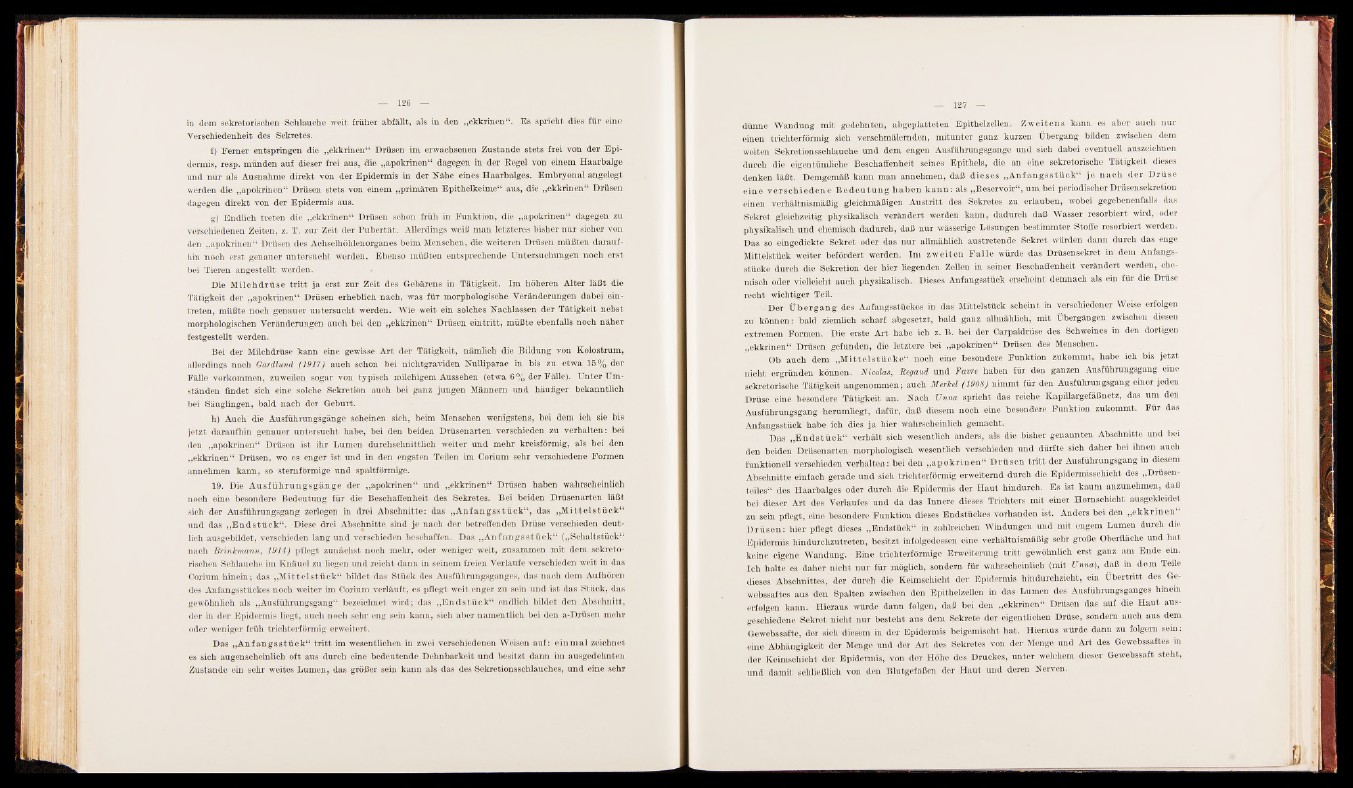
in dem sekretorischen Schlauche weit früher abfällt, als in den „ekkrinen“. Es spricht dies für eine
Verschiedenheit des Sekretes.
f) Ferner entspringen die „ekkrinen“ Drüsen im erwachsenen Zustande stets frei von der Epidermis,
resp. münden auf dieser frei aus, die „apokrinen“ dagegen in der Regel von einem Haarbalge
und nur als Ausnahme direkt von der Epidermis in der Nähe eines Haarbalges. Embryonal angelegt
werden die „apokrinen“ Drüsen stets von einem „primären Epithelkeime“ aus, die „ekkrinen“ Drüsen
dagegen direkt von der Epidermis aus.
g) Endlich treten die „ekkrinen“ Drüsen schon früh in Funktion, die „apokrinen“ dagegen zu
verschiedenen Zeiten, z. T. zur Zeit der Pubertät. Allerdings weiß man letzteres bisher nur sicher von
den „apokrinen“ Drüsen des Achselhöhlenorganes beim Menschen, die weiteren Drüsen müßten daraufhin
noch erst genauer untersucht werden. Ebenso müßten entsprechende Untersuchungen noch erst
bei Tieren angestellt werden.
Die Milchdrüse tritt ja erst zur Zeit des Gebärens in Tätigkeit. Im höheren Alter läßt die
Tätigkeit der „apokrinen“ Drüsen erheblich nach, was für morphologische Veränderungen dabei ein-
treten, müßte noch genauer untersucht werden. Wie weit ein solches Nachlassen der Tätigkeit nebst
morphologischen Veränderungen auch bei den „ekkrinen“ Drüsen eintritt, müßte ebenfalls noch näher
festgestellt werden.
Bei der Milchdrüse kann eine gewisse Art der Tätigkeit, nämlich die Bildung von Kolostrum,
allerdings nach Gardlund (1917) auch schon bei nichtgraviden Nulliparae in bis zu etwa 15% der
Fälle Vorkommen, zuweilen sogar von typisch milchigem Aussehen (etwa 6% der Fälle). Unter Umständen
findet sich eine solche Sekretion auch bei ganz jungen Männern und häufiger bekanntlich
bei Säuglingen, bald nach der Geburt.
h) Auch die Ausführungsgänge scheinen sich, beim Menschen wenigstens, bei dem ich sie bis
jetzt daraufhin genauer untersucht habe, bei den beiden Drüsenarten verschieden zu verhalten: bei
den „apokrinen“ Drüsen ist ihr Lumen durchschnittlich weiter und mehr kreisförmig, als bei den
„ekkrinen“ Drüsen, wo es enger ist und in den engsten Teilen im Corium sehr verschiedene Formen
annehmen kann, so sternförmige und spaltförmige.
19. Die Au sfü h ru n g sg än g e der „apokrinen“ und „ekkrinen“ Drüsen haben wahrscheinlich
noch eine besondere Bedeutung für die Beschaffenheit des Sekretes. Bei beiden Drüsenarten läßt
sich der Ausführungsgang zerlegen in drei Abschnitte: das „A n fan g sstü ck “, das „M itte lstü ck “
und das „E ndstück“. Diese drei Abschnitte sind je nach der betreffenden Drüse verschieden deutlich
ausgebildet, verschieden lang und verschieden beschaffen. Das „A n fan g sstü ck “ („Schaltstück“
nach Brinkmann, 1914) pflegt zunächst noch mehr, oder weniger weit, zusammen mit dem sekretorischen
Schlauche im Knäuel zu liegen und reicht dann in seinem freien Verlaufe verschieden weit in das
Corium hinein; das „M itte lstü ck “ bildet das Stück des Ausführungsganges, das nach dem Aufhören
des Anfangsstückes noch weiter im Corium verläuft, es pflegt weit enger zu sein und ist das Stück, das
gewöhnlich als „Ausführungsgang“ bezeichnet wird; das „E n d stü ck “ endlich bildet den Abschnitt,
der in der Epidermis liegt, auch noch sehr eng sein kann, sich aber namentlich bei den a-Drüsen mehr
oder weniger früh trichterförmig erweitert.
Das „A n fan g sstü ck “ tritt im wesentlichen in zwei verschiedenen Weisen auf: e inm a l zeichnet
es sich augenscheinlich oft aus durch eine bedeutende Dehnbarkeit und besitzt dann im ausgedehnten
Zustande ein sehr weites Lumen, das größer sein kann als das des Sekretionsschlauches, und eine sehr
dünne Wandung mit gedehnten, abgeplatteten Epithelzellen. Zw eiten s kann es aber auch nur
einen trichterförmig sieh verschmälemden, mitunter ganz kurzen Übergang bilden zwischen dem
weiten Sekretionsschlauche und dem engen Ausführungsgange und sich dabei eventuell auszeichnen
durch die eigentümliche Beschaffenheit seines Epithels, die an eine sekretorische Tätigkeit dieses
denken läßt. Demgemäß kann man annehmen, daß die ses „Anfan g sstü ck“ je nach der Drüse
ein e v e r s c h ie d e n e B ed eu tu n g haben kann: als „Reservoir“, um bei periodischer Drüsensekretion
einen verhältnismäßig gleichmäßigen Austritt des Sekretes zu erlauben, wobei gegebenenfalls das
Sekret gleichzeitig physikalisch verändert werden kann, dadurch daß Wasser resorbiert wird, oder
physikalisch und chemisch dadurch, daß nur wässerige Lösungen bestimmter Stoffe resorbiert werden.
Das so eingedickte Sekret oder das nur allmählich austretende Sekret würden dann durch das enge
Mittelstück weiter befördert werden. Im zw eiten F a lle würde das Drüsensekret in dem Anfangsstücke
durch die Sekretion der hier liegenden Zellen in seiner Beschaffenheit verändert werden, chemisch
oder vielleicht auch physikalisch. Dieses Anfangsstück erscheint demnach als ein für die Drüse
recht wichtiger Teil.
. Der Übergang des Anfangsstückes in das Mittelstück scheint in verschiedener Weise erfolgen
zu können: bald ziemlich scharf abgesetzt, bald ganz allmählich, mit Übergängen zwischen diesen
extremen Formen. Die erste Art habe ich z. B. bei der Carpaldrüse des Schweines in den dortigen
„ekkrinen“ Drüsen gefunden, die letztere bei „apokrinen“ Drüsen des Menschen.
Ob auch dem „M itte lstü ck e“ noch eine besondere Funktion zukommt, habe ich bis jetzt
nicht ergründen können. Nicolas, Regaud und Favre haben für den ganzen Ausführungsgang eine
sekretorische Tätigkeit angenommen; auch Merkel (1908) nimmt für den Ausführungsgang einer jeden
Drüse eine besondere Tätigkeit an. Nach Unna spricht das reiche Kapillargefäßnetz, das um den
Ausführungsgang herumliegt, dafür, daß diesem noch eine besondere Funktion zukommt. Für das
Anfangsstück habe ich dies ja hier wahrscheinlich gemacht.
Das „E ndstück“ verhält sich wesentlich anders, als die bisher genannten Abschnitte und bei
den beiden Drüsenarten morphologisch wesentlich verschieden und dürfte sich daher bei ihnen auch
funktionell verschieden verhalten: bei den „apokrinen“ Drüsen tritt der Ausführungsgang m diesem
Abschnitte einfach gerade und sich trichterförmig erweiternd durch die Epidermisschicht des „Drüsenteiles“
des Haarbalges oder durch die Epidermis der Haut hindurch. Es ist kaum anzunehmen, daß
bei dieser Art des Verlaufes und da das Innere dieses Trichters mit einer Hornschicht ausgekleidet
zu sein pflegt, eine besondere Funktion dieses Endstückes vorhanden ist. Anders bei den „ekkrinen“
Drüsen: hier pflegt dieses „Endstück“ in zahlreichen Windungen und mit engem Lumen durch die
Epidermis hindurchzutreten, besitzt infolgedessen eine verhältnismäßig sehr große Oberfläche und hat
keine eigene Wandung. Eine trichterförmige Erweiterung tritt gewöhnlich erst ganz am Ende em.
Ich halte es daher nicht nur für möglich, sondern für wahrscheinlich (mit Unna), daß in dem Teile
dieses Abschnittes, der durch die Keimschicht der Epidermis hindurchzieht, ein Übertritt des Ge-
webssaftes aus den Spalten zwischen den Epithelzellen in das Lumen des Ausführimgsganges hinein
erfolgen kann. Hieraus würde dann folgen, daß bei den „ekkrinen“ Drüsen das auf die Haut ausgeschiedene
Sekret nicht nur besteht aus dem Sekrete der eigentlichen Drüse, sondern auch aus dem
Gewebssafte, der sich diesem in der Epidermis beigemischt hat. Hieraus würde dann zu folgern sein:
eine Abhängigkeit der Menge und der Art des Sekretes von der Menge und Art des Gewebssaftes in
der Keimschicht der Epidermis, von der Höhe des Druckes, unter welchem dieser Gewebssaft steht,
und damit schließlich von den Blutgefäßen der Haut und deren Nerven.