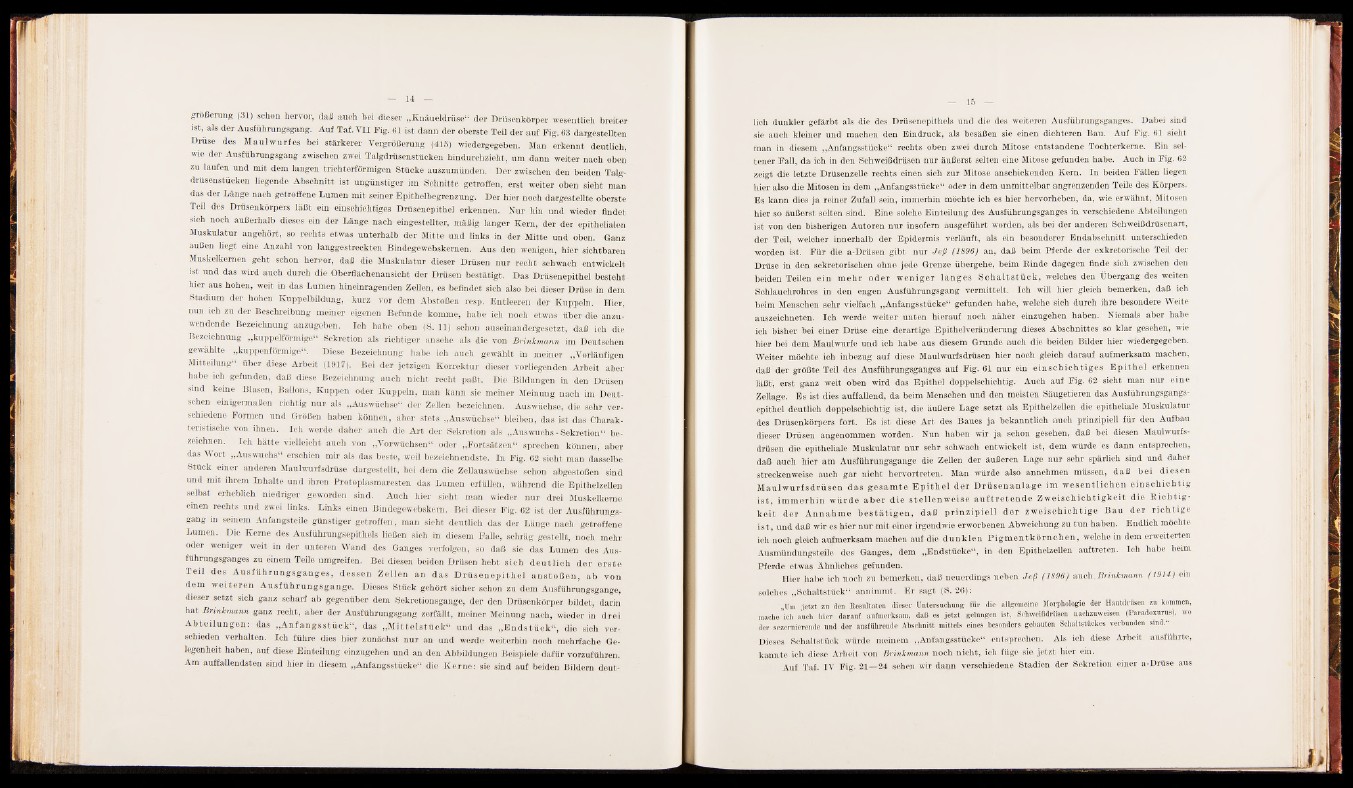
größerung (31).schon hervor, daß auch bei dieser „Knäueldmse“ der Drüsenkörper wesentlich breiter
ist, als der Ausführungsgang. Auf Taf. VII Kg. 61 ist dann der oberste Teil der auf Mg. 63 dargestellten
Drüse des Maulwurfes bei stärkerer Vergrößerung (418) wiedergegeben. Man erkennt deutlich,
wie der Ausführungsgang zwischen zwei Talgdrüsenstücken hindurchzieht, um dann weiter nach oben
zu laufen und mit dem langen trichterförmigen Stücke auszumünden. Der zwischen den beiden Talgdrusenstücken
liegende Abschnitt ist ungünstiger im Schnitte getroffen, erst weiter oben sieht man
das der Länge nach getrödene Lumen mit seiner Epithelbegrenzung. Der hier noch dargestellte oberste
Teil des Drüsenkörpers läßt ein einschichtiges Drüsenepithel erkennen. Nur hin und wieder findet
sich noch außerhalb dieses ein der Länge nach eingestellter, mäßig langer Kern, der der epithelialen
Muskulatur angehört, so rechts etwas unterhalb der Mitte und links in der Mitte und oben. Ganz
außen liegt eine Anzahl von langgestreckten BindegewebBkernen. Aus den wenigen, hier sichtbaren
Muskelkernen geht schon hervor, daß die Muskulatur dieser Drüsen nur recht schwach entwickelt
ist und das wird auch durch die Oberflächenansicht der Drüsen bestätigt. Das Drüsenepithel besteht ■
hier ans hohen, weit in das Lumen hineinragenden Zellen, es befindet sich also bei dieser Drüse in dem
Stadium der hohen Kuppelbildung, kurz vor dem Abstoßen resp. Entleeren der Kuppeln. Hier,
nun ich zu der Beschreibung meiner eigenen Befunde komme, habe ich noch etwas über die
wendende Bezeichnung anzügeben. Ich habe oben (S. 11) schon auseinandergesetzt, daß ich -die
Bezeichnung „kuppelförmige“ Sekretion als richtiger ansehe als die von Brinkmann im Deutschen
gewählte „kuppenförmige“. Diese Bezeichnung habe ich auch gewählt in meiner „Vorläufigen
Mitteilung“ über diege Arbeit (1917). Bei der jetzigen Korrektur dieser vorliegenden^Arbeit aber
habe ich gefunden, daß diese Bezeichnung auch nicht recht paßt. Die Bildungen-in den Drüsen
sind keine Blasen, Ballons, Kuppen oder Kuppeln, man kann sie meiner Meinungen ach im.-Deutschen
einigermaßen richtig nur als „Auswüchse“ der Zellen bezeiämen. Auswüchse, die sehr verschiedene
Formen und Größen haben können, aber stets „Auswüchse“ bleiben, das ist das Charakteristische
von. ihnen.- Ich werde daher auch die Art der Sekretion als „Auswuchs - Sekretion“ bezeichnen.
Ich hätte vielleicht auch von „Vorwüchsen“ oder „Fortsätzen“ sprechen können, aber
das Wort „Auswuchs“ erschien mir als das beste, weil bezeichnendste. In Fig. 62 sieht man dasselbe
Stück einer anderen Maulwurfsdrüse dargestellt, bei dem die ZeUauswüchserhchbn abgestoßen sind
und mit ihrem Inhalte und ihren Protoplasmaresten das Lumen erfüllen, während die Epitheizelhsh
selbst erheblich niedriger geworden sind. Auch hier sieht 'man wieder nur drei Muskelkeme
einen rechts und zwei links. Links einen Bindegewebskem. Bei dieser Fig. 62 ist der Ausführung^
gang in seinem Anfangsteile günstiger getroffen, man sieht deutlich das der Länge nach getroffene
Lumen. Die Kerne des Ausführungsepithels ließen sich in diesem Falle, schräg gestellt, noch mehr
oder weniger weit in der unteren Wand des Ganges verfolgen, so daß sie das Lumen des Aus-
fiihrungsganges zu einem Teile umgreifen. Bei diesen beiden Drüsen hebt sich d eu tlich der e rste
T eil des A u sfü h ru n g sg an g e s, dessen Zellen an das D rü sen ep ith e l a n s toß en , ab von
dem w e ite ren Ausführungsgange. Dieses Stück gehört sicher schon zu dem Ausführungsgange,
dieser setzt sich ganz scharf ab gegenüber dem Sekretionsgange, der den Drüsenkörper bildet, darin
hat Brinkmann ganz recht, aber der Ausführungsgang zerfällt, meiner Meinung nach, wieder in drei
A b te ilu n g en : das „A n fan g sstü ck “, das „M itte lstü ck “ und das „E n d stü ck “, die sich verschieden
verhalten. Ich führe dies hier zunächst nur an und werde weiterhin noch mehrfache Gelegenheit
haben, auf diese Einteilung einzugehen und an den Abbildungen Beispiele dafür vorzuführen.
Am auffallendsten sind hier in diesem „Anfangsstücke“ die Kerne: sie sind auf beiden Bildern deutlieh
dunkler gefärbt als die des Drüsenepithels und die des weiteren Ausführungsganges. Dabei sind
sie auch kleiner und machen den Eindruck, als besäßen sie einen dichteren Bau. Auf Fig. 61 sieht
man in diesem „Anfangsstücke“ rechts oben zwei durch Mitose entstandene Tochterkerne. Ein seltener
Fall, da ich in den Schweißdrüsen nur äußerst selten eine Mitose gefunden habe. Auch in Fig. 62
zeigt die letzte Drüsenzelle rechts einen sich zur Mitose anschickenden Kern. In beiden Fällen liegen
hier also die Mitosen in dem „Anfangsstücke“ oder in dem unmittelbar angrenzenden Teile des Körpers.
Es kann dies ja reiner Zufall sein, immerhin möchte ich es hier hervorheben, da, wie erwähnt, Mitosen
hier so äußerst selten sind. Eine solche Einteilung des Ausführungsganges in verschiedene Abteilungen
ist von den bisherigen Autoren nur insofern ausgeführt worden, als bei der anderen Schweißdrüsenart,
der Teil, welcher innerhalb der Epidermis verläuft, als ein besonderer Endabschnitt unterschieden
worden ist. Für die a-Drüsen gibt nur Jeß (1896) an, daß beim Pferde der exkretorische Teil der
Drüse in den sekretorischen ohne jede Grenze übergehe, beim Binde dagegen finde sich zwischen den
beiden Teilen ein mehr oder weniger lang e s S c h a lt stü c k , welches den Übergang des weiten
Schlauchrohres in den engen Ausführungsgang vermittelt. Ich will hier gleich bemerken, daß ich
beim Menschen sehr vielfach „Anfangsstücke“ gefunden habe, welche sich durch ihre besondere Weite
auszeichneten. Ich werde weiter unten hierauf noch näher einzugehen haben. Niemals aber habe
ich bisher bei einer Drüse eine derartige Epithelveränderung dieses Abschnittes so klar gesehen, wie
hier bei dem Maulwurfe und ich habe aus diesem Grunde auch die beiden Bilder hier wiedergegeben.
Weiter möchte ich inbezug auf diese Maulwurfsdrüsen hier noch gleich darauf aufmerksam machen,
daß der größte Teil des Ausführungsganges auf Fig. 61 nur ein e in s ch ich tig e s E p ith e l erkennen
läßt", erst ganz weit oben wird das Epithel doppelschichtig. Auch auf Fig. 62 sieht man nur eine
Zellage. Es ist dies auffallend, da beim Menschen und den meisten Säugetieren das Ausführungsgangsepithel
deutlich doppelschichtig ist, die äußere Lage setzt als Epithelzellen die epitheliale Muskulatur
des Drüsenkörpers fort. Es ist diese Art des Baues ja bekanntlich auch prinzipiell für den Aufbau
dieser Drüsen angenommen worden. Nun haben wir ja schon gesehen, daß bei diesen Maulwurfsdrüsen
die epitheliale Muskulatur nur sehr schwach entwickelt ist, dem würde es dann entsprechen,
daß auch hier am Ausführungsgange die Zellen der äußeren Lage nur sehr spärlich sind und daher
streckenweise auch gar nicht hervortreten. Man würde also annehmen müssen, daß bei diesen
Maulwurfsdrüsen das g e sam te E p ith e l der D rü sen an la g e im w e sen tlich en e in s ch ich tig
is t , immerhin würde aber die s te lle nw e is e a u ftr e ten d e Z w e is ch ich tig k e it die N ic h t ig k
e it der Annahme b e s tä tig e n , daß p r in z ip ie ll der zw e is ch ich tig e Bau der r ich tig e
is t , und daß wir es hier nur mit einer irgendwie erworbenen Abweichung zu tun haben. Endlich möchte
ich noch gleich aufmerksam machen auf die dunklen P igm en tk ö rn ch en , welche in dem erweiterten
Ausmündungsteile des Ganges, dem „Endstücke“, in den Epithelzellen auftreten. Ich habe beim
Pferde etwas Ähnliches gefunden.
Hier habe ich noch zu bemerken, daß neuerdings neben Jeß (1896) auch,Brinkmann (1914) ein
solches „Schaltstück“ annimmt. Er sagt (S. 26):
„Um jetzt zu den Resultaten dieser Untersuchung für die allgemeine Morphologie der Hautdrüsen zu kommen,
mache'ich auch hier darauf aufmerksam, daß es jetzt gelungen ist, Schweißdrüsen nachzuweisen (Paradoxurus), wo
der sezernierende und der ausführende Abschnitt mittels eines besonders gebauten Schaltstückes verbunden sind.“
Dieses Schaltstück würde meinem „Anfangsstücke“ entsprechen. Als ich diese Arbeit ausführte,
kannte ich diese Arbeit von Brinkmann noch nicht, ich füge sie jetzt hier ein.
Auf Taf. IV Fig. 21—24 sehen wir dann verschiedene Stadien der Sekretion einer a-Drüse aus