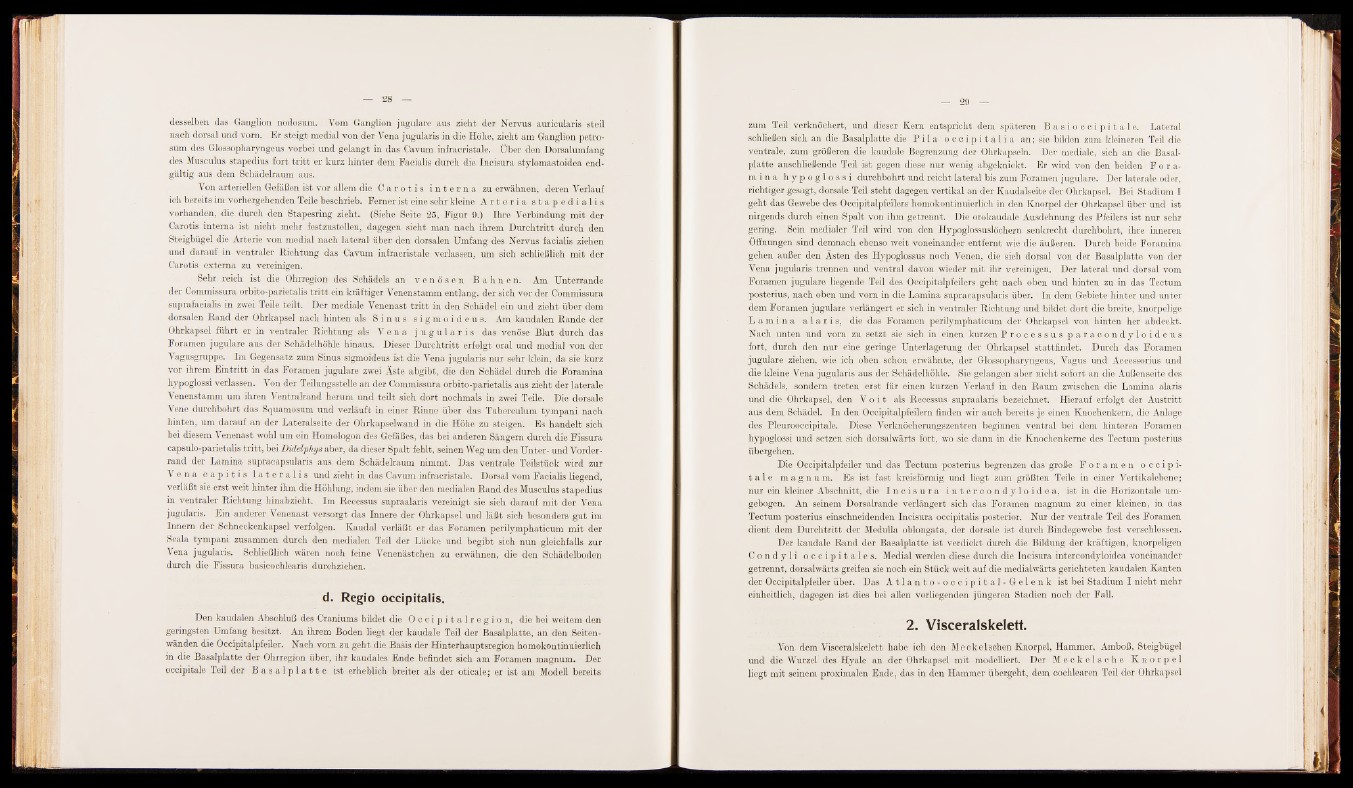
desselben das Ganglion nodosum. Vom Ganglion jugulare aus zieht der Nervus auricularis steil
nach dorsal und vorn. E r steigt medial von der Vena jugularis in die Höhe, zieht am Ganglion petro-
sum des Glossopharyngeus vorbei und gelangt in das Cavum infracristale. Über den Dorsalumfang
des Musculus stapedius fort tr i t t er kurz hinter dem Facialis durch die Incisura stylomastoidea endgültig
aus dem Schädelraum aus.
Von arteriellen Gefäßen ist vor allem die C a r o t i s i n t e r n a zu erwähnen, deren Verlauf
ich bereits im vorhergehenden Teile beschrieb. Ferner ist eine sehr kleine A r t e r i a s t a p e d i a l i s
vorhanden, die durch den Stapesring zieht. (Siehe Seite 25, Figur 9.) Ihre Verbindung mit der
Carotis interna ist nicht mehr festzustellen, dagegen sieht man nach ihrem D urchtritt durch den
Steigbügel die Arterie von medial nach lateral über den dorsalen Umfang des Nervus facialis ziehen
und darauf in ventraler Richtung das Cavum infracristale verlassen, um sich schließlich mit der
Carotis externa zu vereinigen.
Sehr reich ist die Ohrregion des Schädels an v e n ö s e n B a h n e n . Am Unterrande
der Commissura orbito-parietalis tr i t t ein kräftiger Venenstamm entlang, der sich vor der Commissura
suprafacialis in zwei Teile teilt. Der mediale Venenast t r i t t in den Schädel ein und zieht über dem
dorsalen Rand der Ohrkapsel nach hinten als S i n u s s i g m o i d e u s . Am kaudalen Rande der
Ohrkapsel führt er in ventraler Richtung als V e n a j u g u l a r i.s das venöse Blut durch das
Foramen jugulare aus der Schädelhöhle hinaus. Dieser D urchtritt erfolgt oral und medial von der
Vagusgruppe. Im Gegensatz zum Sinus sigmoideus ist die Vena jugularis nur sehr klein, da sie kurz
vor ihrem E in tritt in das Foramen jugulare zwei Äste abgibt, die den Schädel durch die Foramina
hypoglossi verlassen. Von der Teilungsstelle an der Commissura. orbito-parietalis aus zieht der laterale
Venenstamm um ihren Ventralrand herum und te ilt sich d o rt nochmals in zwei Teile. Die dorsale
Vene durchbohrt das Squamosum und verläuft in einer Rinne über das Tuberculum tympani nach
hinten, um darauf an der Lateralseite der Ohrkapselwand in die Höhe zu steigen. Es handelt sich
bei diesem Venenast wohl um ein Homologon des Gefäßes, das bei anderen Sängern durch die Fissura
capsulo-parietalis tr itt, bei Diddphys aber, da dieser Spalt fehlt, seinen Weg um den Unter- und Vorderrand
der Lamina supracäpsularis aus dem Schädelraum nimmt. Das ventrale Teilstück wird zur
V e n a c a p i t i s l a t e r a l i s und zieht in das Cavum infracristale. Dorsal vom Facialis liegend,
verläßt sie erst weit hinter ihm die Höhlung, indem sie über den medialen R and des Musculus stapedius
in ventraler Richtung hinabzieht. Im Recessus supraalaris vereinigt sie sich darauf mit der Vena
jugularis. Ein anderer Venenast versorgt das Innere der Ohrkapsel und läßt sich besonders gut im
Innern der Schneckenkapsel verfolgen. Kaudal verläßt er das Foramen perilymphaticum mit der
Scala tympani zusammen durch den medialen Teil der Lücke und begibt sich nun gleichfalls zur
Vena jugularis. Schließlich wären noch feine Venenästchen zu erwähnen, die den Schädelboden
durch die Fissura basicochlearis durchziehen.
d . R e g io o c c ip ita lis .
Den kaudalen Abschluß des Craniums bildet die O c c i p i t a l r e g i o n , die bei weitem den
geringsten Umfang besitzt. An ihrem Boden liegt der. kaudale Teil der Basalplatte, an den .Seitenwänden
die Oceipitalpfeiler. Nach v om zu g eht die. Basis der Hinterhauptsregion homokontinuierlich
in die Basalplatte der Ohrregion über, ihr kaudales Ende befindet sich am Foramen magnum. Der
occipitale Teil der B a s a l p l a t t e ist erheblich breiter als der oticale; er ist am Modell bereits
zum Teil verknöchert, und dieser Kern entspricht dem späteren B a s i o c c i p i t a l e . Lateral
schließen sich an die Basalplatte die P i l a o c c i p i t a l i a an; sie bilden zum kleineren Teil die
ventrale, zum größeren die kaudale Begrenzung der Ohrkapseln. Der mediale, sich an die Basalp
la tte anschließende Teil ist gegen diese nur wenig abgeknickt. E r wird von den beiden F o r a m
i n a h y p o g l o s s i durchbohrt und reicht lateral bis zum Foramen jugulare. Der laterale oder,
richtiger gesagt, dorsale Teil steht dagegen vertikal an der Kaudalseite der Ohrkapsel. Bei Stadium I
geht das Gewebe des Occipitalpfeilers homokontinuierlich in den Knorpel der Ohrkapsel über und ist
nirgends durch einen Spalt von ihm getrennt. Die orokaudale Ausdehnung des Pfeilers ist nur sehr
gering. Sein medialer Teil wird von den Hypoglossuslöchern senkrecht durchbohrt, ihre inneren
Öffnungen sind demnach ebenso weit voneinander entfernt wie die äußeren. Durch beide Foramina
gehen außer den Ästen des Hypoglossus noch Venen, die sich dorsal von der Basalplatte von der
Vena jugularis trennen und ventral davon wieder mit ihr vereinigen. Der lateral und dorsal vom
Foramen jugulare liegende Teil des Occipitalpfeilers geht nach oben und hinten zu in das Tectum
posterius, nach oben und vorn in die Lamina supracapsularis über. In dem Gebiete hinter und unter
dem Foramen jugulare verlängert er sich in ventraler Richtung und bildet d o rt die breite, knorpelige
L a m i n a a l a r i s , die das Foramen perilymphaticum der Ohrkapsel von hinten her abdeckt.
Nach unten und vorn zu setzt sie sich in einen kurzen P r o c e s s u s p a r a c o n d y l o i d e u s
fort, durch den nur eine geringe Unterlagerung der Ohrkapsel stattfindet. Durch das Foramen
jugulare ziehen, wie ich oben schon erwähnte, der Glossopharyngeus, Vagus und Accessorius und
die kleine Vena jugularis aus der Schädelhöhle. Sie gelangen aber nicht sofort an die Außenseite des
Schädels, sondern treten erst für einen kurzen Verlauf in den Raum zwischen die Lamina alaris
und die Ohrkapsel, den V o i t als Recessus supraalaris bezeichnet. Hierauf erfolgt der Austritt
aus dem Schädel. In den Occipitalpfeilern finden wir auch bereits je einen Knochenkern, die Anlage
des Pleurooccipitale. Diese Verknöcherungszentren beginnen ventral bei dem hinteren Foramen
hypoglossi und setzen sich dorsalwärts fort, wo sie dann in die Knochenkerne des Tectum posterius
übergehen.
Die Oceipitalpfeiler und das Tectum posterius begrenzen das große F o r a m e n o o c i p i -
t a l e m a g n u m . Es ist fa st kreisförmig und liegt zum größten Teile in einer Vertikalebene;
nur ein kleiner Abschnitt, die I n c i s u r a i n t e r c o n d y l o i d e a , ist in die Horizontale umgebogen.
An seinem Dorsalrande verlängert sich das Foramen magnum zu einer kleinen, in das
Tectum posterius einschneidenden Incisura occipitalis posterior. Nur der ventrale Teil des Foramen
dient dem D urchtritt der Medulla oblongata, der dorsale ist durch Bindegewebe fest verschlossen.
Der kaudale Rand der Basalplatte ist verdickt durch die Bildung der kräftigen, knorpeligen
C o n d y l i o c c i p i t a l e s. Medial werden diese durch die Incisura intercondyloidea voneinander
getrennt, dorsalwärts greifen sie noch ein Stück weit auf die medialwärts gerichteten kaudalen Kanten
der Oceipitalpfeiler über. Das A t l a n t o - o c c i p i t a l - G e l e n k ist bei Stadium I nicht mehr
einheitlich, dagegen ist dies bei allen vorliegenden jüngeren Stadien noch der Fall.
2. Visceralskelett.
Von dem Visceralskelett habe ich den M ecke lschen Knorpel, Hammer, Amboß, Steigbügel
und die Wurzel des Hyale an der Ohrkapsel mit modelliert. Der M e c k e 1 s c h e K n o r p e l
liegt mit seinem proximalen Ende, das in den Hammer übergeht, dem cochlearen Teil der Ohrkapsel