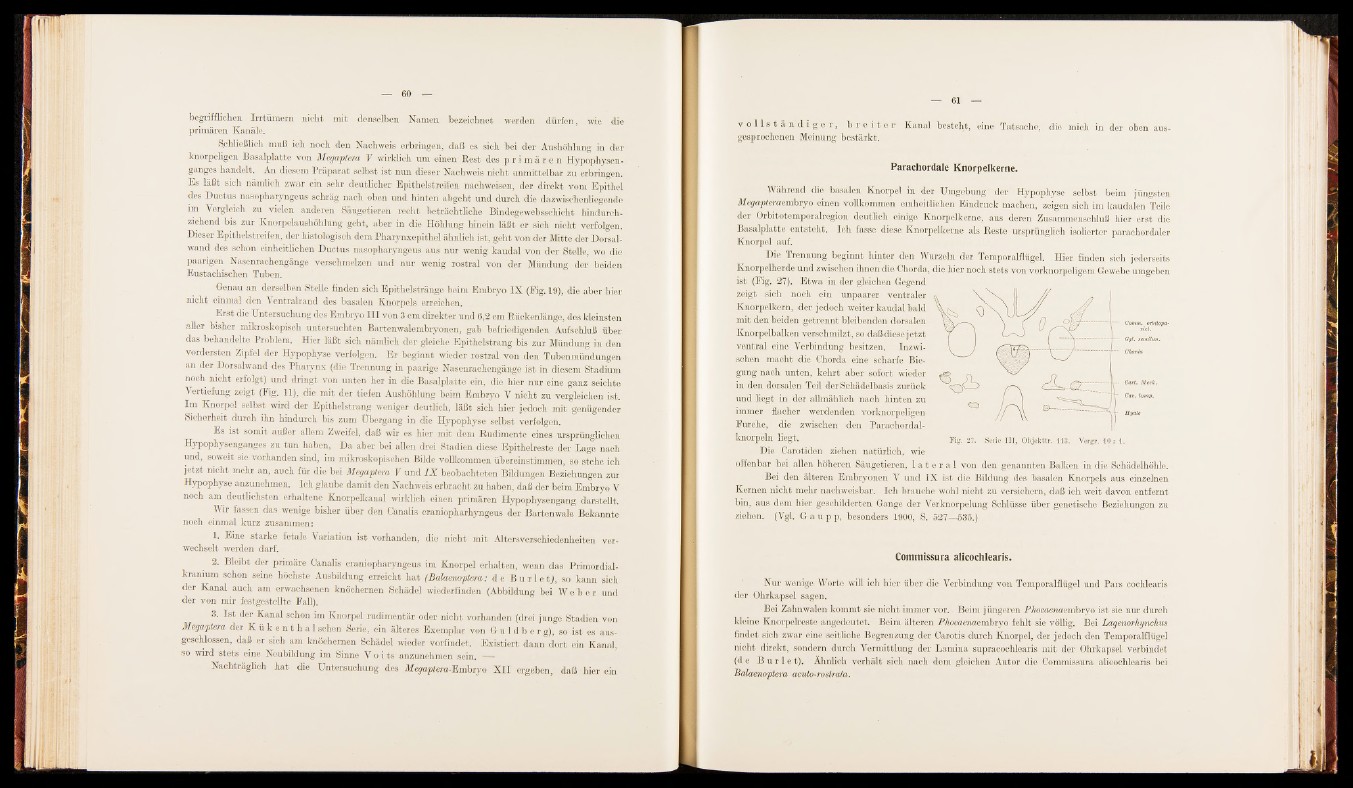
begrifflichen Irrtümern nicht mit denselben Namen bezeichnet werden dürfen, wie die
primären Kanäle.
Schließlich muß ich noch den Nachweis erbringen, daß es sich bei der Aushöhlung in der
knorpeligen Basalplatte von Megaptera V wirklich um einen Rest des p r i m ä r e n Hypophysenganges
handelt. An diesem Präp a ra t selbst ist nun dieser Nachweis nicht unmittelbar zu erbringen.
Es läßt sich nämlich zwar ein sehr deutlicher Epithelstreifen nachweisen, der direkt vom Epithel
des Ductus nasopharyngeus schräg nach oben und hinten abgeht und durch die dazwischenliegende
im Vergleich zu vielen anderen Säugetieren recht beträchtliche Bindegewebsschicht hindurchziehend
bis zur Knorpelaushöhlung geht, aber in die Höhlung hinein läßt er sich nicht verfolgen.
Dieser Epithelstreifen, der histologisch dem Pharynxepithel ähnlich ist, geht von der M itte der Dorsalwand
des schon einheitlichen Ductus nasopharyngeus aus nur wenig kaudal von der Stelle, wo die
paarigen Nasenrachengänge verschmelzen und nur wenig rostral von der Mündung der beiden
Eustachischen Tuben.
Genau an derselben Stelle finden sich Epithelstränge beim Embryo IX (Fig. 19), die aber hier
nicht einmal den Ventralrand des basalen Knorpels erreichen.
E rst die Untersuchung des Embryo I I I von 3 cm direkter und 6,2 cm Rückenlänge, des kleinsten
aller bisher mikroskopisch untersuchten Bartenwalembryonen, gab befriedigenden Aufschluß über
das behandelte Problem. Hier läß t sich nämlich der gleiche Epithelstrang bis zur Mündung in den
vordersten Zipfel der Hypophyse verfolgen. E r beginnt wieder rostral von den Tubenmündungen
an der Dorsalwand des Pharynx (die Trennung in paarige Nasenrachengänge ist in diesem Stadium
noch nicht erfolgt) und dringt von unten her in die Basalplatte ein, die hier nur eine ganz seichte
Vertiefung zeigt (Fig. 11), die mit der tiefen Aushöhlung beim Embryo V nicht zu vergleichen ist.
Im Knorpel selbst wird der Epithelstrang weniger deutlich, läß t sich hier jedoch mit genügender
Sicherheit durch ihn hindurch bis zum Übergang in die Hypophyse selbst verfolgen.
Es ist somit außer allem Zweifel, daß wir es hier mit dem Rudimente eines ursprünglichen
Hypophysenganges zu tu n haben, Da aber bei aßen drei Stadien diese Epithelreste der Lage nach
und, soweit sie vorhanden sind, im mikroskopischen Bilde vollkommen übereinstimmen, so stehe ich
je tz t nicht mehr an, auch für die bei Megaptera V und I X beobachteten Bildungen Beziehungen zur
Hypophyse anzunehmen. Ich glaube damit den Nachweis erbracht zu haben, daß der beim Embryo V
noch am deutlichsten erhaltene Knorpelkanal wirklich einen primären Hypophysengang darstellt.
Wir fassen das wenige bisher über den Canalis craniopharhyngeus der Bartenwale Bekannte
noch einmal kurz zusammen:
1. Eine starke fetale Variation ist vorhanden, die nicht mit Altersverschiedenheiten vor-
wechselt werden darf.
2. Bleibt der primäre Canalis craniopharyngeus im Knorpel erhalten, wenn das Primordialkranium
schon seine höchste Ausbildung erreicht h a t (Balaenoptera: d e B u r l e t), so kann sich
der Kanal auch am erwachsenen knöchernen Schädel wiederfinden (Abbildung bei W e b e r und
der von mir festgestellte Fall).
3. Is t der Kanal schon im Knorpel rudimentär oder nicht vorhanden (drei junge Stadien von
Megaptera der K ü k e n t h a l sehen Serie, ein älteres Exemplar von G u 1 d b e r g), so ist es ausgeschlossen,
daß er sich am knöchernen Schädel wieder vorfindet. Existiert dann dort ein Kanal,
so wird stets eine Neubildung im Sinne V o i ts anzunehmen sein. —
Nachträglich h a t die Untersuchung des Megaptera-Embryo X I I ergeben, daß hier ein
v o 11 s t a n d l g e r , b r e i t e r
gesprochenen Meinung bestärkt.
Aanal besteht, eine latsache, die mich in der oben
Parachordale Knorpelkerne.
Während die basalen Knorpel in der Umgebung der Hypophyse Selbst beim jüngsten
Megapteraembryo einen vollkommen einheitlichen Eindruck ihaehen, zeigen sieh im kaudalen Teile
der Orbitotemporalregion deutlich einige Knorpelkemcpiras deren Zusammenschluß hier erst die
Basalplatte entsteht. Ich fasse diese Knorpelkeme als Reste ursprünglich isolierter parachordaler
Knorpel auf.
Die Trennung beginnt hinter den Wurzeln der Temporalflügel. Hier finden sich jederseits
Knorpelherde und zwischen ihnen die Chorda, die hier noch stets von vorknorpeligem Gewebe umgeben
ist (Fig. 27). Etwa in der gleichen Gegend
zeigt sich noch ein unpaarer ventraler
Knorpelkern, der jedoch weiter kaudal bald
mit den beiden getrennt bleibenden dorsalen
Knorpelbalken verschmilzt, so daß diese jetzt
ventral eine Verbindung besitzen. Inzwischen
macht die Chorda eine scharfe Biegung
nach unten, kehrt aber sofort wieder
in den dorsalen Teil der Schädelbasis zurück
und hegt in der allmählich nach hinten zu
immer flacher werdenden vorknorpeligen
Furche, die zwischen den Parachordal-
knorpeln liegt.
Die Carotiden ziehen natürlich, wie
Ggl. semilun.
Chorda
Objektti
offenbar bei ahen höheren Säugetieren, l a t e r a l von den genannten Balken in die Schädelhöhle.
Bei den älteren Embryonen V und IX ist die Bildung des basalen Knorpels aus einzelnen
Kernen nicht mehr nachweisbar. Ich brauche wohl nicht zu versichern, daß ich weit davon entfernt
bin, aus dem hier geschilderten Gange der Verknorpelung Schlüsse über genetische Beziehungen zu
ziehen. (Vgl. G a u p p, besonders 1900, S. 527—535.)
Commissura alicochlearis.
Nur wenige Worte wih ich hier über die Verbindung von Temporalflügel und Pars cochlearis
der Ohrkapsel sagen.
Bei Zahnwalen kommt sie nicht immer vor. Beim jüngeren Phocaenaembryo ist sie nur durch
kleine Knorpelreste angedeutet. Beim älteren Phocaenaembiyo fehlt sie völlig. Bei Lagenorhynchus
findet sich zwar eine seitliche Begrenzung der Carotis durch Knorpel, der jedoch den Temporalflügel
nicht direkt, sondern durch Vermittlung der Lamina supracochlearis mit der Ohrkapsel verbindet
(d e B u r 1 e t) . Ähnlich verhält sich nach dem gleichen Autor die Commissura alicochlearis bei
Balaenoptera acuto-rostraia.