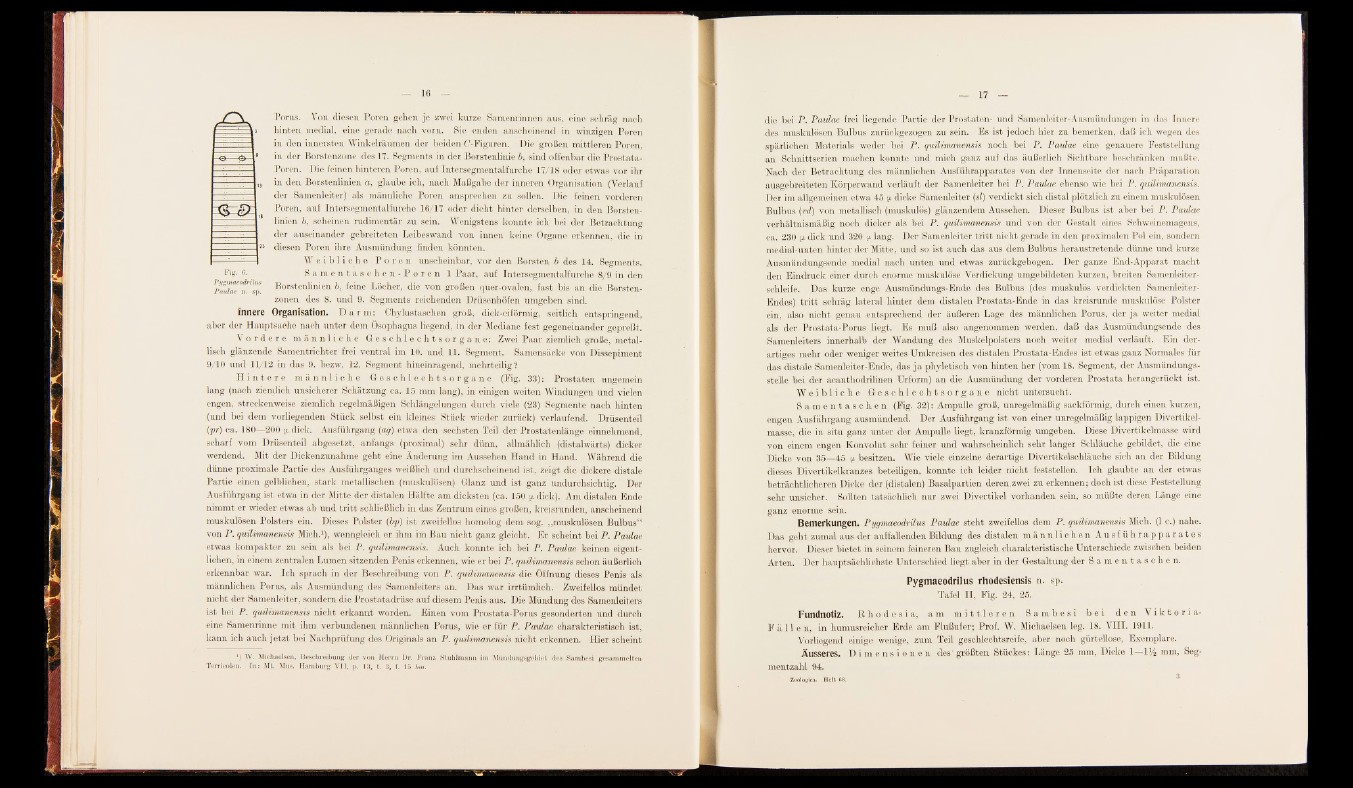
'=(S>=m
Fig. 6.
Pygmaeodrilus
Paulae n. sp.
Poriis. Von diesen Poren gehen je zwei kurze Samenrinnen aus, eine schräg nach
hinten medial, eine gerade nach vorn. Sie enden anscheinend in winzigen Poren
in den innersten Winkelräumen der beiden (7-Figuren. Die großen mittleren Poren,
in der Borstenzone des 17. Segments in der Borstenlinie b, sind offenbar die Prostata-
Poren. Die feinen h interen Poren, auf Intersegmentalfurche 17/18 oder etwas vor ihr
in den Borstenlinien a, glaube ich, nach Maßgabe der inneren Organisation (Verlauf
der Samenleiter) als männliche Poren ansprechen zu sollen. Die feinen vorderen
Poren, auf Intersegmentalfurche 16/17 oder dicht hinter derselben, in den Borstenlinien
b, scheinen rudimentär zu sein. Wenigstens konnte ich bei der Betrachtung
der auseinander gebreiteten Leibeswand von innen keine Organe erkennen, die in
diesen Poren ihre Ausmündung finden könnten.
W e i b l i c h e P o r e n unscheinbar, vor den Borsten b des 14. Segments.
S a m e n t a s c h e n - P o r e n 1 Paar, auf Intersegmentalfurche 8/9 in den
Borstenlinien b, feine Löcher, die von großen quer-ovalen, fast bis an die Borstenzonen
des 8. und 9. Segments reichenden Drüsenhöfen umgeben sind.
Innere Organisation. D a r m : Chylustaschen groß, dick-eiförmig, seitlich entspringend,
aber der Hauptsache nach unter dem Ösophagus liegend, in der Mediane fest gegeneinander gepreßt.
V o r d e r e m ä n n l i c h e G e s c h l e c h t s o r g a n e : Zwei Paar ziemlich große, metallisch
glänzende Samentrichter frei ventral im 10. und 11. Segment. Samensäcke von Dissepiment
9/10 und 11/12 in das 9. bezw. 12. Segment hineinragend, mehrteilig?
H i n t e r e m ä n n l i c h e G e s c h l e c h t s o r g a n e (Fig. 33): Prostaten ungemein
lang (nach ziemlich unsicherer Schätzung ca. 15 mm lang), in einigen weiten Windungen und vielen
engen, streckenweise ziemlich regelmäßigen Schlängelungen durch viele (23) Segmente nach hinten
(und bei dem vorliegenden Stück selbst ein kleines Stück wieder zurück) verlaufend. Drüsenteil
(pr) ca. 180—200 y. dick. Ausführgang {ag) etwa den sechsten Teil der Prostatenlänge einnehmend,
scharf vom Drüsenteil abgesetzt, anfangs (proximal) sehr dünn, allmählich (distalwärts) dicker
werdend. Mit der Dickenzunahme geht eine Änderung im Aussehen Hand in Hand. Während die
dünne proximale Partie des Ausführganges weißlich und durchscheinend ist, zeigt die dickere distale
Partie einen gelblichen, stark metallischen (muskulösen) Glanz und ist ganz undurchsichtig. Der
Ausführgang ist etwa in der Mitte der distalen Hälfte am dicksten (ca. 150 dick). Am distalen Ende
nimmt er wieder etwas ab und tr i tt schließlich in das Zentrum eines großen, kreisrunden, anscheinend
muskulösen Polsters ein. Dieses Polster (bp) ist zweifellos homolog dem sog. „muskulösen Bulbus“
von P . quüimanensis Mich.1), wenngleich er ihm im B au nicht ganz gleicht. E r scheint bei P. Pavlae
etwas kompakter zu sein als bei P. quüimanensis. Auch konnte ich bei P. Paulae keinen eigentlichen,
in einem zentralen Lumen sitzenden Penis erkennen, wie er bei P. quüimanensis schon äußerlich
erkennbar war. Ich sprach in der Beschreibung von P. quüimanensis die Öffnung dieses Penis als
männlichen Porus, als Ausmündung des Samenleiters an. Das war irrtümlich. Zweifellos mündet
nicht der Samenleiter, sondern die P rostatadrüse auf diesem Penis aus. Die Mündung des Samenleiters
ist bei P. quüimanensis nicht erkannt worden. Einen vom Prostata-Porus gesonderten und durch
eine Samenrinne mit ihm verbundenen männlichen Porus, wie er für P. Paulae charakteristisch ist,
kann ich auch je tz t bei Nachprüfung des Originals an P. quüimanensis nicht erkennen. Hier scheint
l) W. Michaelsen, BeschreiJ
rricolen. In: Mt. Mus. Hamburg
iung der
VII, p.
von Herrn Dr. Franz Stuhlmann im Mündungsgebiet des Sambesi gesammelten
13, t. 3, f. 15 bm.
die bei P. Paulae frei liegende Partie der Prostaten- und Samenleiter-Ausmündungen in das Innere
des muskulösen Bulbus zurückgezogen zu sein. Es ist jedoch hier zu bemerken, daß ich wegen des
spärlichen Materials weder bei P . quüimanensis noch bei P. Paulae eine genauere Feststellung
an Schnittserien machen konnte und mich ganz auf das äußerlich Sichtbare beschränken mußte.
Nach der Betrachtung des männlichen Ausführapparates von der Innenseite der nach Präparation
ausgebreiteten K örperwand verläuft der Samenleiter bei P. Paulae ebenso wie bei P. quüimanensis.
Der im allgemeinen etwa 45 p. dicke Samenleiter (sl) verdickt sich distal plötzlich zu einem muskulösen
Bulbus (vd) von metallisch (muskulös) glänzendem Aussehen. Dieser Bulbus ist aber bei P. Paulae
verhältnismäßig noch dicker als bei P . quüimanensis und von der Gestalt eines Schweinemagens,
ca. 230 p. dick und 320 p. lang. Der Samenleiter tr i tt nicht gerade in den proximalen Pol ein, sondern
medial-unten hinter der Mitte, und so ist auch das aus dem Bulbus heraustretende dünne und kurze
Ausmündungsende medial nach unten und etwas zurückgebogen. Der ganze End-Apparat macht
den Eindruck einer durch enorme muskulöse Verdickung umgebildeten kurzen, breiten Samenleiterschleife.
Das kurze enge Ausmündungs-Ende des Bulbus (des muskulös verdickten Samenleiter-
Endes) tr i t t schräg lateral hinter dem distalen Prostata-Ende in das kreisrunde muskulöse Polster
ein, also nicht genau entsprechend der äußeren Lage des männlichen Porus, der ja weiter medial
als der Prostata-Porus hegt. Es muß also angenommen werden, daß das Ausmündungsende des
Samenleiters innerhalb der Wandung des Muskelpolsters noch weiter medial verläuft. Ein derartiges
mehr oder weniger weites Umkreisen des distalen P rostata-Endes ist etwas ganz Normales für
das distale Samenleiter-Ende, das ja phyletisch von hinten her (vom 18. Segment, der Ausmündungsstelle
bei der acanthodrilinen Urform) an die Ausmündung der vorderen Prostata herangerückt ist.
W e i b l i c h e G e s c h l e c h t s o r g a n e nicht untersucht.
S a m e n t a s c h e n (Fig. 32): Ampulle groß, unregelmäßig sackförmig, durch einen kurzen,
engen Ausführgang ausmündend. Der Ausführgang ist von einer unregelmäßig lappigen Divertikelmasse,
die in situ ganz unter der Ampulle hegt, kranzförmig umgeben. Diese Divertikelmasse wird
von einem engen Konvolut sehr feiner und wahrscheinlich sehr langer Schläuche gebildet, die eine
Dicke von 35—45 {j. besitzen. Wie viele einzelne derartige Divertikelschläuche sich an der Bildung
dieses Divertikelkranzes beteihgen, konnte ich leider nicht feststellen. Ich glaubte an der etwas
beträchthcheren Dicke der (distalen) Basalpartien deren.zwei zu erkennen; doch ist diese Feststellung
sehr unsicher. SoUten tatsächlich nur zwei Divertikel vorhanden sein, so müßte deren Länge eine
ganz enorme sein.
Bemerkungen. Pygmaeodrüus Paulae steht zweifellos dem P. quüimanensis Mich. (1 c.) nahe.
Das geht zumal aus der auffallenden Bildung des distalen m ä n n l i c h e n A u s f ü h r a p p a r a t e s
hervor. Dieser bietet in seinem feineren Bau zugleich charakteristische Unterschiede zwischen beiden
Arten. Der hauptsächlichste Unterschied liegt aber in der Gestaltung der S a m e n t a s c h e n .
Pygmaeodrilus rhodesiensis n. sp.
Tafel II , Fig. 24, 25.
Fundnotiz. R h o d e s i a , a m m i t t l e r e n S a m b e s i b e i d e n V i k t o r i a -
F ä l l e n , in humusreicher Erde am Flußufer; Prof. W. Michaelsen leg. 18. VIII. 1911.
Vorliegend einige wenige, zum Teil geschlechtsreife, aber noch gürtellose, Exemplare.
Äusseres. D i m e n s i o n e n des' größten Stückes: Länge 25 mm, Dicke 1—1% mm, Segmentzahl
94.
Zoologien. Heft 08.