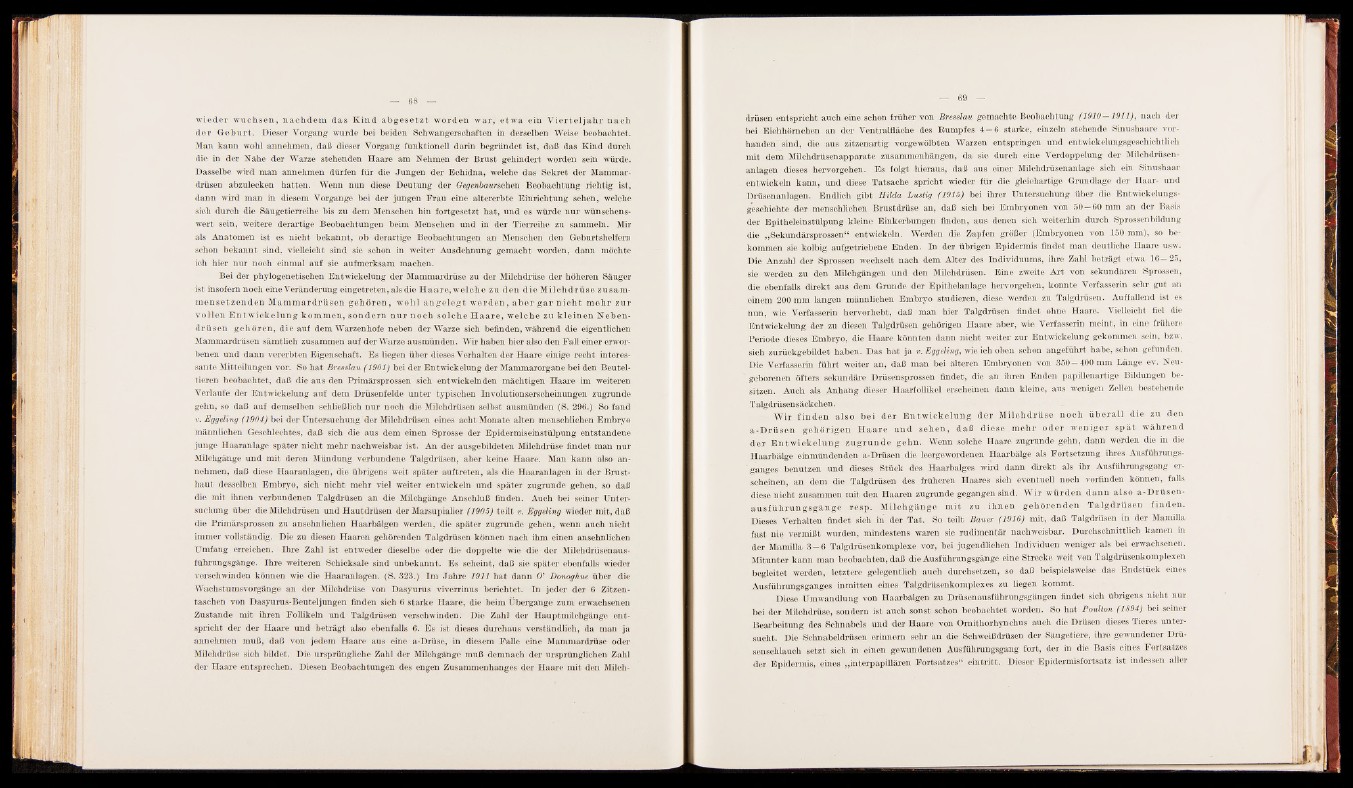
wieder w uchsen , nachd em das Kind a b g e s e tz t worden war, e tw a ein V ie r te lja h r nach
der Geburt. Dieser Vorgang wurde bei beiden Schwangerschaften in derselben Weise beobachtet.
Man kann wohl annehmen, daß dieser Vorgang funktionell darin begründet ist, daß das Kind durch
die in der Nähe der Warze stehenden Haare am Nehmen der Brust gehindert worden sein würde.
Dasselbe wird man annehmen dürfen für die Jungen der Echidna, welche das Sekret der Mammardrüsen
abzulecken hatten. Wenn nun diese Deutung der Gegeribaurschen. Beobachtung richtig ist,
dann wird man in diesem Vorgänge bei der jungen Frau eine altererbte Einrichtung sehen, welche
sich durch die Säugetierreihe bis zu dem Menschen hin fortgesetzt hat, und es würde nur wünschenswert
sein, weitere derartige Beobachtungen beim Menschen und in der Tierreihe zu sammeln. Mir
als Anatomen ist es nicht bekannt, ob derartige Beobachtungen an Menschen den Geburtshelfern
schon bekannt sind, vielleicht sind sie schon in weiter Ausdehnung gemacht worden, dann möchte
ich hier nur noch einmal auf sie aufmerksam machen.
Bei der phylogenetischen Entwickelung der Mammardrüse zu der Milchdrüse der höheren Säuger
ist insofern noch eine Veränderung eingetreten, als die Haare, welche zu den die Milchdrüse zusamm
ense tz en den Mammardrüsen g ehören , wohl an g e le g t werden, aber gar n ic h t mehr zur
v o llen E n tw ick e lu n g kommen, sondern nur noch so lch e Haare, w e lch e zu k le in en N ebendrüsen
gehören, die auf dem Warzenhofe neben der Warze sich befinden, während die eigentlichen
Mammardrüsen sämtlich zusammen auf der Warze ausmünden. Wir haben hier also den Fall einer erworbenen
und dann vererbten Eigenschaft. Es liegen über dieses Verhalten der Haare einige recht interessante
Mitteilungen vor. So hat Bresslau (1901) bei der Entwickelung der Mammarorgane bei den Beuteltieren
beobachtet, daß die aus den Primärsprossen sich entwickelnden mächtigen Haare im weiteren
Verlaufe der Entwickelung auf dem Drüsenfelde unter typischen Involutionserscheinungen zugrunde
gehn, so daß auf demselben schließlich nur noch die Milchdrüsen selbst ausmünden (S. 296.) So fand
v. Eggeling (1904) bei der Untersuchung der Milchdrüsen eines acht Monate alten menschlichen Embryo
männlichen Geschlechtes, daß sich die aus dem einen Sprosse der Epidermiseinstülpung entstandene
junge Haaranlage später nicht mehr nachweisbar ist. An der ausgebildeten Milchdrüse findet man nur
Milchgänge und mit deren Mündung verbundene Talgdrüsen, aber keine Haare. Man kann also annehmen,
daß diese Haaranlagen, die übrigens weit später auftreten, als die Haaranlagen in der Brusthaut
desselben Embryo, sich nicht mehr viel weiter entwickeln und später zugrunde gehen, so daß
die mit ihnen verbundenen Talgdrüsen an die Milchgänge Anschluß finden. Auch bei seiner Untersuchung
über die Milchdrüsen und Hautdrüsen der Marsupialier (1905) teilt v. Eggeling wieder mit, daß
die Primärsprossen zu ansehnlichen Haarbälgen werden, die später zugrunde gehen, wenn auch nicht
immer vollständig. Die zu diesen Haaren gehörenden Talgdrüsen können nach ihm einen ansehnlichen
Umfang erreichen. Ihre Zahl ist entweder dieselbe oder die doppelte wie die der Milchdrüsenausführungsgänge.
Ihre weiteren Schicksale sind unbekannt. Es scheint, daß sie später ebenfalls wieder
verschwinden können wie die Haaranlagen. (S. 323.) Im Jahre 1911 hat dann 0 ’ Donoghue über die
Wachstumsvorgänge an der Milchdrüse von Dasyurus viverrinus berichtet. In jeder der 6 Zitzentaschen
von Dasyurus-Beuteljungen finden sich 6 starke Haare, die beim Übergange zum erwachsenen
Zustande mit ihren Follikeln und Talgdrüsen verschwinden. Die Zahl der Hauptmilchgänge entspricht
der der Haare und beträgt also ebenfalls 6. Es ist dieses durchaus verständlich, da man ja
annehmen muß, daß von jedem Haare aus eine a-Drüse, in diesem Falle eine Mammardrüse oder
Milchdrüse sich bildet. Die ursprüngliche Zahl der Milchgänge muß demnach der ursprünglichen Zahl
der Haare entsprechen. Diesen Beobachtungen des engen Zusammenhanges der Haare mit den Milchdrüsen
entspricht auch eine schon früher von Bresslau gemachte Beobachtung (1910—1911), nach der
bei Eichhörnchen an der Ventralfläche des Rumpfes 4 - 6 starke, einzeln stehende Sinushaare vorhanden"^
sind, die aus zitzenartig vorgewölbten Warzen entspringen und entwickelungsgeschichtlich
mit dem Milchdrüsenapparate Zusammenhängen, da sie durch eine Verdoppelung der Milchdrüsenanlagen
dieses hervorgehen. Es folgt hieraus, daß aus einer Milchdrüsenanlage sich ein Sinushaar
entwickeln kann, und diese Tatsache spricht wieder für die gleichartige Grundlage der Haar- und
Drüsenanlagen. Endlich gibt Hilda Lustig (1915) bei ihrer Untersuchung über die Entwickelungsgeschichte
der menschlichen Brustdrüse an, daß sich bei Embryonen von 50 —60 mm an der Basis
der Epitheleinstülpung kleine Einkerbungen finden, aus denen sich weiterhin durch Sprossenbildung
die „Sekundärsprossen“ entwickeln. Werden die Zapfen größer (Embryonen von 150 mm), so bekommen
sie kolbig auf getriebene Enden. In der übrigen Epidermis findet man deutliche Haare usw.
Die Anzahl der Sprossen wechselt nach dem Alter des Individuums, ihre Zahl beträgt etwa 1 6 -2 5 ,
sie werden zu den Milchgängen und den Milchdrüsen. Eine zweite Art von sekundären Sprossen,
die ebenfalls direkt aus dem Grunde der Epithelanlage hervorgehen, konnte Verfasserin sehr gut an
einem 200 mm langen männlichen Embryo studieren, diese werden zu Talgdrüsen. Auffallend ist es
nun, wie Verfasserin hervorhebt, daß man hier Talgdrüsen findet ohne Haare. Vielleicht fiel die
Entwickelung der, zu diesen Talgdrüsen gehörigen Haare aber, wie Verfasserin meint, in eine frühere
Periode dieses Embryo, die Haare könnten dann nicht weiter zur Entwickelung gekommen sein, bzw.
sich zurückgebildet haben. Das hat ja v. Eggeling, wie ich oben schon angeführt habe, schon gefunden.
Die Verfasserin führt weiter an, daß man bei älteren Embryonen von 350-400 mm Länge ev. Neu-
‘ geborenen öfters sekundäre Drüsensprossen findet, die an ihren Enden papillenartige Bildungen besitzen.
Auch als Anhang dieser Haarfollikel erscheinen daun kleine, aus wenigen Zellen bestehende
Talgdrüsensäckchen.
Wir fin d en also bei der E n tw ick e lu n g der Milchdrüse noch üb era ll die zu den
a-Drüsen gehör igen Haare und seh en , daß d ie se mehr oder weniger sp ä t während
der E n tw ick e lu n g zugrunde gehn. Wenn solche Haare zugrunde gehn, dann werden die in die
Haarbälge einmündenden a-Drüsen die leergewordenen Haarbälge als Fortsetzung ihres Ausführungs-
ganges benutzen und dieses Stück des Haarbalges wird dann direkt als ihr Ausführungsgang erscheinen,
an dem die Talgdrüsen des früheren Haares sich eventuell noch vorfinden können, falls
diese nicht zusammen mit den Haaren zugrunde gegangen sind. Wir würden dann also a-Drüsen-
a u sfü h ru n g sg än g e resp. Milchgänge mit zu ihnen gehörenden Talgdrüsen finden.
Dieses Verhalten findet sich in der Tat. So teilt Bauer (1916) mit, daß Talgdrüsen in der Mamilla
fast nie vermißt wurden, mindestens waren sie rudimentär nachweisbar. Durchschnittlich kamen in
der Mamilla 3—6 Talgdrüsenkomplexe vor, bei jugendlichen Individuen weniger als bei erwachsenen.
Mitunter kann man beobachten, daß die Ausführungsgänge eine Strecke weit von Talgdrüsenkomplexen
begleitet werden, letztere gelegentlich auch durchsetzen, so daß beispielsweise das Endstück eines
Ausführungsganges inmitten eines Talgdrüsenkomplexes zu liegen kommt.
Diese Umwandlung von Haarbälgen zu Drüsenausführungsgängen findet sich übrigens nicht nur
bei der Milchdrüse, sondern ist auch sonst schon beobachtet worden. So hat Poulton (1894) bei seiner
Bearbeitung des Schnabels und der Haare von Ornithorhynchus auch die Drüsen dieses Tieres untersucht.
Die Schnabeldrüsen erinnern sehr an die Schweißdrüsen der Säugetiere, ihre gewundener Drüsenschlauch
setzt sich in einen gewundenen Ausführungsgang fort, der in die Basis eines Fortsatzes
der Epidermis, eines „interpapillären Fortsatzes“ eintritt. Dieser Epidermisfortsatz ist indessen aller