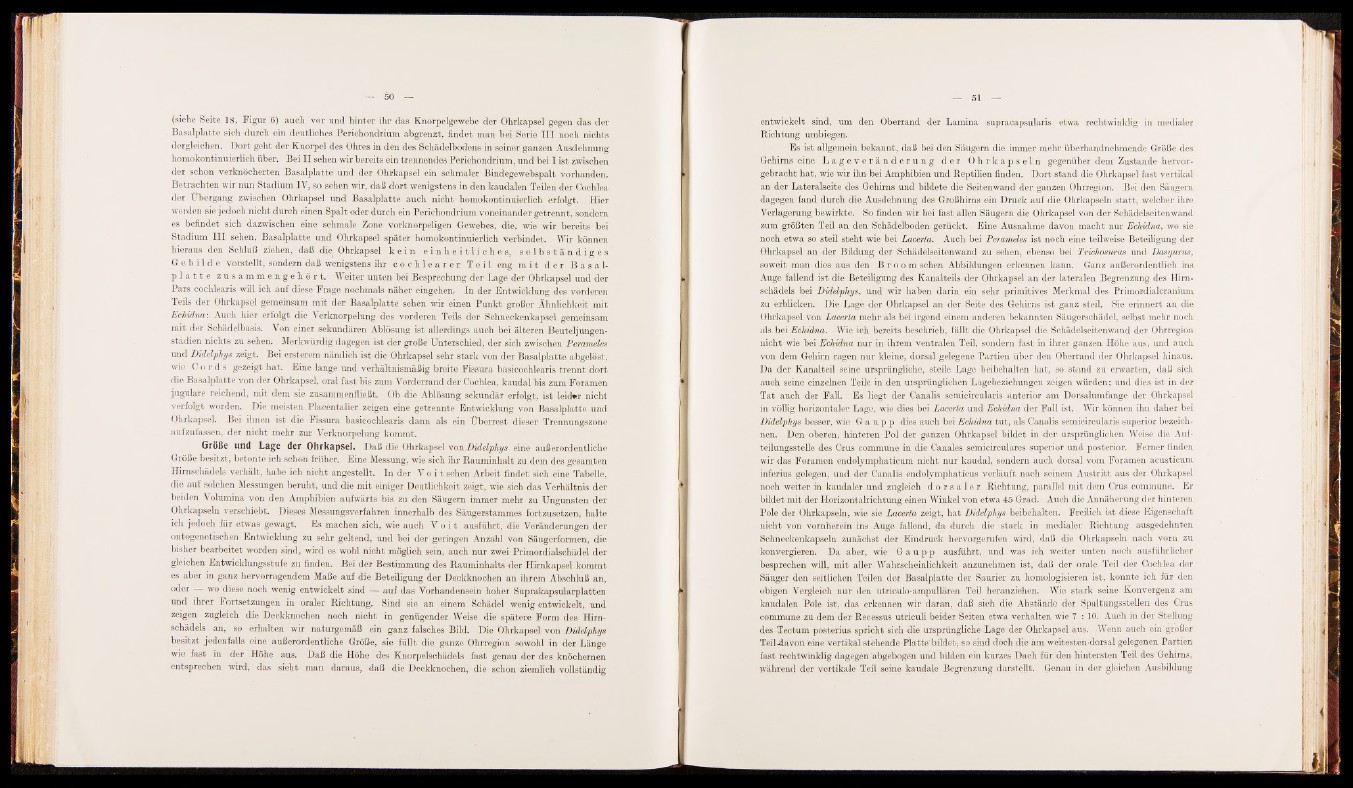
(siehe Seite 18, Figur 6) auch vor und hinter ihr das Knorpelgewebe der Ohrkapsel gegen das der
Basalplatte sich durch ein deutliches Perichondrium abgrenzt, findet man bei Serie I I I noch nichts
dergleichen. Dort geht der K norpel des Ohres in den des Schädelbodens in seiner ganzen Ausdehnung
homokontinuierlich über. Bei I I sehen wir bereits ein trennendes Perichondrium, und bei I ist zwischen
der schon verknöcherten Basalplatte und der Ohrkapsel ein schmaler Bindegewebspalt vorhanden.
Betrachten wir nun Stadium IV, so sehen wir, daß dort wenigstens in den kaudalen Teilen der Cochlea
der Übergang zwischen Ohrkapsel und Basalplatte auch nicht homokontinuierlich erfolgt. Hier
werden sie jedoch n icht durch einen S palt oder durch ein Perichondrium voneinander getrennt, sondern
es befindet sich dazwischen eine schmale Zone vorknorpeligen Gewebes, die, wie wir bereits bei
Stadium I I I sehen, Basalplatte und Ohrkapsel später homokontinuierlich verbindet. Wir können
hieraus den Schluß ziehen, daß die Ohrkapsel k e i n e i n h e i t l i c h e s , s e l b s t ä n d i g e s
G e b i l d e vorstellt, sondern daß wenigstens ihr c o c h l e a r e r T e i l eng m i t d e r B a s a l p
l a t t e z u s a m m e n g e h ö r t . Weiter unten bei Besprechung der Lage der Ohrkapsel und der
Pars cochlearis will ich auf diese Frage nochmals näher eingehen. In der Entwicklung des vorderen
Teils der Ohrkapsel gemeinsam mit der Basalplatte sehen wir einen P u n k t großer Ähnlichkeit mit
Echidna: Auch hier erfolgt die Verknorpelung des vorderen Teils der Schneckenkapsel gemeinsam
m it der Schädelbasis. Von einer sekundären Ablösung ist allerdings auch bei älteren Beuteljungenstadien
nichts zu sehen. Merkwürdig dagegen is t der große Unterschied, der sich zwischen Perameles
und Didelphys zeigt. Bei ersterem nämlich ist die Ohrkapsel sehr stark von der Basalplatte abgelöst,
wie C o r d s gezeigt hat. Eine lange und verhältnismäßig breite Fissura basicochlearis trennt dort
die Basalplatte von der Ohrkapsel, oral fast bis zum Vorderrand der Cochlea, kaudal bis zum Foramen
jugulare reichend, mit dem sie zusammenfließt. Ob die Ablösung sekundär erfolgt, ist leider nicht
verfolgt worden. Die meisten Placentalier zeigen eine getrennte Entwicklung von Basalplatte und
Ohrkapsel. Bei ihnen ist die Fissura basicochlearis dann als ein Überrest dieser Trennungszone
aufzufassen, der nicht mehr zur Verknorpelung kommt.
Größe und Lage der Ohrkapsel. Daß die Ohrkapsel von Didelphys eine außerordentliche
Größe besitzt, betonte ich schon früher. Eine Messung, wie sich ihr Rauminhalt zu dem des gesamten
Hirnschädels verhält, habe ich nicht angestellt. In der V o i t sehen Arbeit findet sich eine Tabelle,
die auf solchen Messungen beruht, und die mit einiger Deutlichkeit zeigt, wie sich das Verhältnis der
beiden Volumina von den Amphibien aufwärts bis zu den Säugern immer mehr zu Ungunsten der
Ohrkapseln verschiebt. Dieses Messungsverfahren innerhalb des Säugerstammes fortzusetzen, halte
ich jedoch für etwas gewagt. Es machen sich, wie auch V o i t ausführt, die Veränderungen der
ontogenetischen Entwicklung zu sehr geltend, und bei der geringen Anzahl von Säugerformen, die
bisher bearbeitet worden sind, wird es wohl nicht möglich sein, auch nur zwei Primordialschädel der
gleichen Entwicklungsstufe zu finden. Bei der Bestimmung des Rauminhalts der Himkapsel kommt
es aber in ganz hervorragendem Maße auf die Beteiligung der Deckknochen an ihrem Abschluß an,
oder wo diese noch wenig entwickelt sind — auf das Vorhandensein hoher Suprakapsularplatten
und ihrer Fortsetzungen in oraler Richtung. Sind sie an einem Schädel wenig entwickelt, und
zeigen zugleich die Deckknochen noch nicht in genügender Weise die spätere Form des Hirnschädels
an, so erhalten wir naturgemäß ein ganz falsches Bild. Die Ohrkapsel von Didelphys
besitzt jedenfalls eine außerordentliche Größe, sie füllt die ganze Ohrregion sowohl in der Länge
wie fast in der Höhe aus. Daß die Höhe des Knorpelschädels fast genau der des knöchernen
entsprechen wird, das sieht man daraus, daß die Deckknochen, die schon ziemlich vollständig
entwickelt sind, um den Oberrand der Lamina supracapsularis etwa rechtwinklig in medialer
Richtung umbiegen.
Es ist allgemein bekannt, daß bei den Säugern die immer mehr überhandnehmende Größe des
Gehirns eine L a g e v e r ä n d e r u n g d e r O h r k a p s e l n gegenüber dem Zustande hervorgebracht
h a t, wie wir ihn bei Amphibien und Reptilien finden. Dort stand die Ohrkapsel fast vertikal
an der Lateralseite des Gehirns und bildete die Seitenwand der ganzen Ohrregion. Bei den Säugern
dagegen fand durch die Ausdehnung des Großhirns ein Druck auf die Ohrkapseln s ta tt, welcher ihre
Verlagerung bewirkte. So finden wir bei fast allen Säugern die Ohrkapsel von der Schädelseitenwand
zum größten Teil an den Schädelboden gerückt. Eine Ausnahme davon macht nur Echidna, wo sie
noch etwa so steil steh t wie bei Lacerta. Auch bei Perameles ist noch eine teilweise Beteiligung der
Ohrkapsel an der Bildung der Schädelseitenwand zu sehen, ebenso bei Trichoswus und Dasyurus,
soweit man dies aus den B r o o m sehen Abbildungen erkennen kann. Ganz außerordentlich ins
Auge fallend ist die Beteiligung des Kanalteils der Ohrkapsel an der lateralen Begrenzung des Hirnschädels
bei Didelphys, und wir haben darin ein sehr primitives Merkmal des Primordialcranium
zu erblicken. Die Lage der Ohrkapsel an der Seite des Gehirns ist ganz steil. Sie erinnert an die
Ohrkapsel von Lacerta mehr als bei irgend einem anderen bekannten Säugerschädel, selbst mehr noch
als bei Echidna. Wie ich bereits beschrieb, füllt die Ohrkapsel die Schädelseitenwand der Ohrregion
nicht wie bei Echidna nur in ihrem ventralen Teil, sondern fast in ihrer ganzen Höhe aus, und auch
von dem Gehirn ragen nur kleine, dorsal gelegene Partien über den Oberrand der Ohrkapsel hinaus.
Da der Kanalteil seine ursprüngliche, steile Lage beibehalten ha t, so stand zu erwarten, daß sich
auch seine einzelnen Teile in den ursprünglichen Lagebeziehungen zeigen würden; und dies ist in der
T a t auch der Fall. Es liegt der Canalis semicircularis anterior am Dorsalumfange der Ohrkapsel
in völlig horizontaler Lage, wie dies bei Lacerta und Echidna der Fall ist. Wir können ihn daher bei
Didelphys besser, wie G a u p p dies auch bei Echidna tu t, als Canalis semicircularis superior bezeichnen.
Den oberen, hinteren Pol der ganzen Ohrkapsel bildet in der ursprünglichen Weise die Aufteilungsstelle
des Crus commune in die Canales semicirculares superior und posterior. Ferner finden
wir das Foramen endolymphaticum nicht nur kaudal, sondern auch dorsal vom Foramen acusticum
inferius gelegen, und der Canalis endolymphaticus verläuft nach seinem Austritt aus der Ohrkapsel
noch weiter in kaudaler und zugleich d o r s a l e r; Richtung, parallel mit dem Crus commune. Er
bildet m it der H orizontalrichtung einen Winkel von etwa 45 Grad. Auch die Annäherung der hinteren
Pole der Ohrkapseln, wie sie Lacerta zeigt, h a t Didelphys beibehalten. Freilich ist diese Eigenschaft
nicht von vornherein ins Auge fallend, da durch die stark in medialer Richtung ausgedehnten
Schneckenkapseln zunächst der Eindruck hervorgerufen wird, daß die Ohrkapseln nach vorn zu
konvergieren. Da aber, wie G a u p p ausführt, und was ich weiter unten noch ausführlicher
besprechen will, mit aller Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß der orale Teil der Cochlea der
Säuger den seitlichen Teilen der Basalplatte der Saurier zu homologisieren ist, konnte ich für den
obigen Vergleich nur den utriculo-ampullären Teil heranziehen. Wie stark seine Konvergenz am
kaudalen Pole ist, das erkennen wir daran, daß sich die Abstände der Spaltungsstellen des Crus
commune zu dem der Recessus utriculi beider Seiten etwa verhalten \fcie 7 : 10. Auch in der Stellung
des Tectum posterius spricht sich die ursprüngliche-Lage der Ohrkapsel aus. Wenn aüch ein großer
Teil-da von eine v ertikal stehende P la tte1 bildet,- so-sind doch die am'weitesten-dorsal gelegenen Partien
fast rechtwinklig dagegen abgebogen und bilden ein kurzes Dach für den hintersten Teil'des Gehirns,
während der vertikale Teil seine kaudale Begrenzung darstellt. Genau in der gleichen Ausbildung