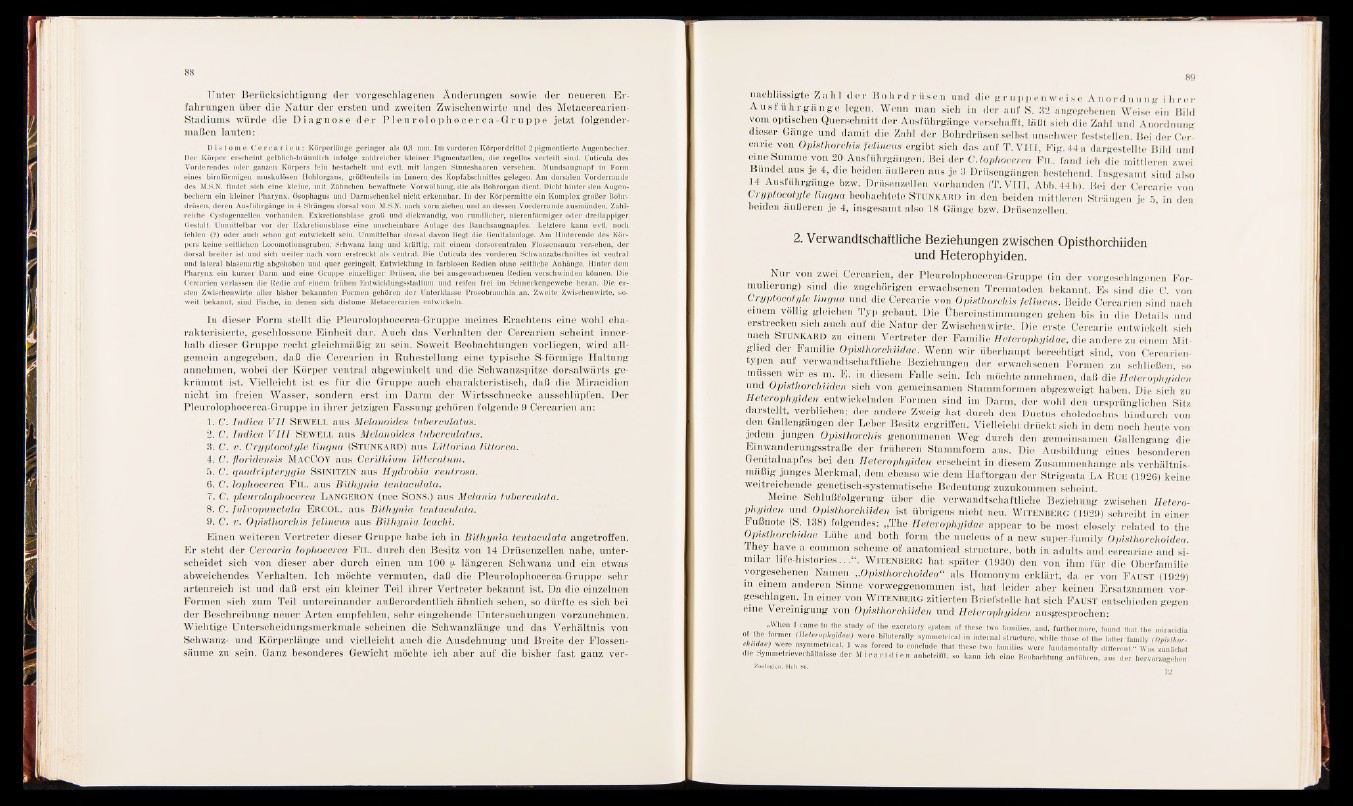
Unter Berücksichtigung der vorgeschlagenen Änderungen sowie der neueren E rfahrungen
über die Natur der ersten und zweiten Zwischen wirte und des Metacer carien-
Stadiuins würde die D i a g n o s e d e r P l e u r o l o p h o c e r c a -G r u p p e jetzt folgendermaßen
lauten:
D i s t o m e C e r c a r i e n : Körperlänge geringer als 0,3 mm. Im vorderen Körperdrittel 2 pigmentierte Augenbecher.
Der Körper erscheint gelblich-bräunlich infolge zahlreicher kleiner Pigmentzellen, d ie regellos verteilt sind. Cuticula des
Vorderendes oder ganzen Körpers fein bestachelt und evtl. mit langen Sinneshaaren versehen. Mundsaugnapf in Form
eines bimförmigen muskulösen Hohlorgans, größtenteils im Innern des Kopfabschnittes gelegen. Am dorsalen Vorderrande
des M.S.N. findet sich eine kleine, mit Zähnchen bewaffnete Vor Wölbung, die als Bohrorgan dient. Dicht hinter den Augenbechern
ein kleiner Pharynx. Ösophagus und Darmschenkel nicht erkennbar. In der Körpermitte ein Komplex großer Bohr-
drüsen, deren Ausführgänge in 4 Strängen dorsal vom M.S.N. nach vorn ziehen und an dessen Vorderrande ausmünden. Zahlreiche
Cystogenzellen vorhanden. Exkretionsblase groß und dickwandig, von rundlicher, nierenförmiger oder dreilappiger
Gestalt. Unmittelbar vor der Exkretionsblase eine unscheinbare Anlage des Bauchsaugnapfes. Letztere kann evtl. noch
fehlen (?) oder auch schon gut entwickelt sein. Unmittelbar dorsal davon liegt die Genitalanlage. Am Hinterende des Körpers
keine seitlichen Locomotionsgruben. Schwanz lang und kräftig, mit einem dorsoventralen Flossensaum versehen, der
dorsal breiter ist und sioh weiter nach vorn erstreckt als ventral. Die Cuticula des vorderen Schwanzabschnittes ist ventral
und lateral blasenartig abgehoben und quer geringelt. Entwicklung in farblosen Redien ohne seitliche Anhänge. Hinter dem
Pharynx ein kurzer Darm und eine Gruppe einzelliger Drüsen, die bei ausgewachsenen Redien verschwinden können. Die
Cercarien verlassen die Redie auf einem frühen Entwicklungsstadium und reifen frei im Schneckengewebe heran. Die ersten
Zwischenwirte aller bisher bekannten Formen gehören der Unterklasse Prosobranchia an. Zweite Zwischenwirte, soweit
bekannt, sind Fische, in denen sich distome Metacercarien entwickeln.
In dieser Form stellt die Pleurolophocerca-Gruppe meines Erachtens eine wohl charakterisierte,
geschlossene Einheit dar. Auch das Verhalten der Cercarien scheint innerhalb
dieser Gruppe recht gleichmäßig zu sein. Soweit Beobachtungen vorliegen, wird allgemein
angegeben, daß die Cercarien in Ruhestellung eine typische S-förmige Haltung
annehmen, wobei der Körper ventral abgewinkelt und die Schwanzspitze dorsalwärts gekrümmt
ist. Vielleicht ist es für die Gruppe auch charakteristisch, daß die Miracidien
nicht im freien Wasser, sondern erst im Darm der Wirtsschnecke ausschlüpfen. Der
Pleurolophocerca-Gruppe in ihrer jetzigen Fassung gehören folgende 9 Cercarien an:
1. C. Indica V II S e w e l l aus Melanoides tuberculatus.
2. C. Indica VIII S e w e l l aus Melanoides tuberculatus.
3. C. v. Cryptocotyle lingua (Stu n k a rd ) a u s Littorina littorea.
4. C. floridensis Ma cCoy a u s Cerithium litteratum.
5. C. quadripterygia S s in it z in a u s Hydrobia ventrosa.
6. C. lophocerca F il. aus Bithynia tentaculata.
7. C. pleurolophocerca L a n g e ro n (nec S o n s .) a u s Melania tuberculata.
8. C. fulvopunctata E r c o l . aus Bithynia tentaculata.
9. C. v. Opisthorchis felineus aus Bithynia leachi.
Einen weiteren Vertreter dieser Gruppe habe ich in Bithynia tentaculata angetroffen.
E r steht der Cercaria lophocerca F i l . durch den Besitz von 14 Drüsenzellen nahe, unterscheidet
sich von dieser aber durch einen um 100 p- längeren Schwanz und ein etwas
abweichendes Verhalten. Ich möchte vermuten, daß die Pleurolophocerca-Gruppe sehr
artenreich ist und daß erst ein kleiner Teil ihrer Vertreter bekannt ist. Da die einzelnen
Formen sich zum Teil untereinander außerordentlich ähnlich sehen, so dürfte es sich bei
der Beschreibung neuer Arten empfehlen, sehr eingehende Untersuchungen vorzunehmen.
Wichtige Unterscheidungsmerkmale scheinen die Schwanzlänge und das Verhältnis von
Schwanz- und Körperlänge und vielleicht auch die Ausdehnung und Breite der Flossensäume
zu sein. Ganz besonderes Gewicht möchte ich aber auf die bisher fast ganz vernachlässigte
Z ah l d e r B o h r d r i i s e n und die g r u p p e nw e i s e A n o r d n u n g i h r e r
A u s f ü h r g ä n g e legen. Wenn man sich in der auf S. 32 angegebenen Weise ein Bild
vom optischen Querschnitt der Ausführgänge verschafft, läßt sich die Zahl und Anordnung
dieser Gänge und damit die Zahl der Bohrdrüsen selbst unschwer feststellen. Bei der Cercarie
von Opisthorchis felineus ergibt sich das auf T. V III, Fig. 44 a dargestellte Bild und
eine Summe von 20 Ausführgängen. Bei der C. lophocerca F i l . fand ich die mittleren zwei
Bündel aus je 4, die beiden äußeren aus je 3 Drüsengängen bestehend. Insgesamt sind also
14 Ausführgänge bzw. Drüsenzellen vorhanden (T.VIII, Abh. 44 b). Bei der Cercarie von
Cryptocotyle lingua beobachtete S t u n k a r d in den beiden mittleren Strängen je 5 , in den
beiden äußerem U ‘4, insgesamt also 18 Gänge bzw. Drüsenzellen.
2. Verwandtschaftliche Beziehungen zwischen Opisthorchiiden
und Heterophyiden.
Nur von zwei Cercarien, der Pleurolophocerca-Gruppe (in der vorgeschlagenen Formulierung)
sind die zugehörigen erwachsenen Trematoden bekannt. Es sind die C. von
Cryptocotyle lingua und die Cercarie von Opisthorchis felineus. Beide Cercarien sind nach
einem völlig gleichen Typ gebaut. Die Übereinstimmungen gehen bis in die Details und
erstrecken sich auch auf die Natur der Zwischenwirte. Die erste Cercarie entwickelt sich
nach S T U N K A R D zu einem Vertreter der Familie Heterophyidae, die andere zu einem Mitglied
der Familie Opisthorchiidae. Wenn wir überhaupt berechtigt sind, von Cercarien-
typen aüf verwandtschaftliche Beziehungen der erwachsenen Formen zu schließen, so
müssen wir es m. Ü. in diesem Falle sein. Ich möchte annehmen, daß die Heterophyiden
und Opisthorchiiden sich von gemeinsamen Stammformen abgezweigt haben. Die sich zu
Heterophyiden entwickelnden Formen sind im Darm, der wohl den ursprünglichen Sitz
darstellt, verblieben; der andere Zweig hat durch den Ductus choledochus hindurch von
den Gallengängen der Leber Besitz ergriffen. Vielleicht drückt sich in dem noch heute von
jedem jungen Opisthorchis genommenen Weg durch den gemeinsamen Gallengang die
Einwanderungsstraße der früheren Stammform aus. Die Ausbildung eines besonderen
Genitalnapfes hei den Heterophyiden erscheint in diesem Zusammenhänge als verhältnismäßig
junges Merkmal, dem ebenso wie dem Haftorgan der Strigeata L a R u e (1926) keine
weitreichende genetisch-systematische Bedeutung zuzukommen scheint.
Meine Schlußfolgerung über die verwandtschaftliche Beziehung zwischen Heterophyiden
und Opisthorchiiden ist übrigens nicht neu. W i t e n b e r g (1929) schreibt in einer
Fußnote (S. 138) folgendes: „The Heterophyidae appcar to be most closely related to the
Opisthorchidae Lühe and both form the nucleus of a new super-family Opisthorchoidea.
They have a common scheme of anatomicaLstructure, both in adults and cercariae and si=.
milar life-histories. . . “. W i t e n b e r g hat später (1930) den von ihm für die Oberfamilie
vorgesehenen Namen „Opisthorchoidea“ als Homonym erklärt, da er von F a u s t (1929)
in einem anderen Sinne vorweggenommen ist, hat leider aber keinen Ersatznamen vorgeschlagen.
In einer von W i t e n b e r g zitierten Briefstelle hat sieh F a u s t entschieden gegen
eine Vereinigung von Opisthorchiiden und Heterophyiden ausgesprochen:
. M W M m t0, th| ‘stady °* U » excretory System of flies« tf jifäm ilie s , and, furthermore, found that the miracidia
Qi the former (Heleropliijiiua) were bilaterally symmetrica! in internal structure, while those oi llie latter family (Ovisthor-
chtidae) were asymmetrical, I was forced to conelude that tliese lwo families were fundamentally different" Was zunächst
Symmetneverhältnisse der M i r a Ci d i e n anbelriflt, so kann ich eine Beobachtung anführen, aus der hervorzugehen
^Zoologien, Heft 86.