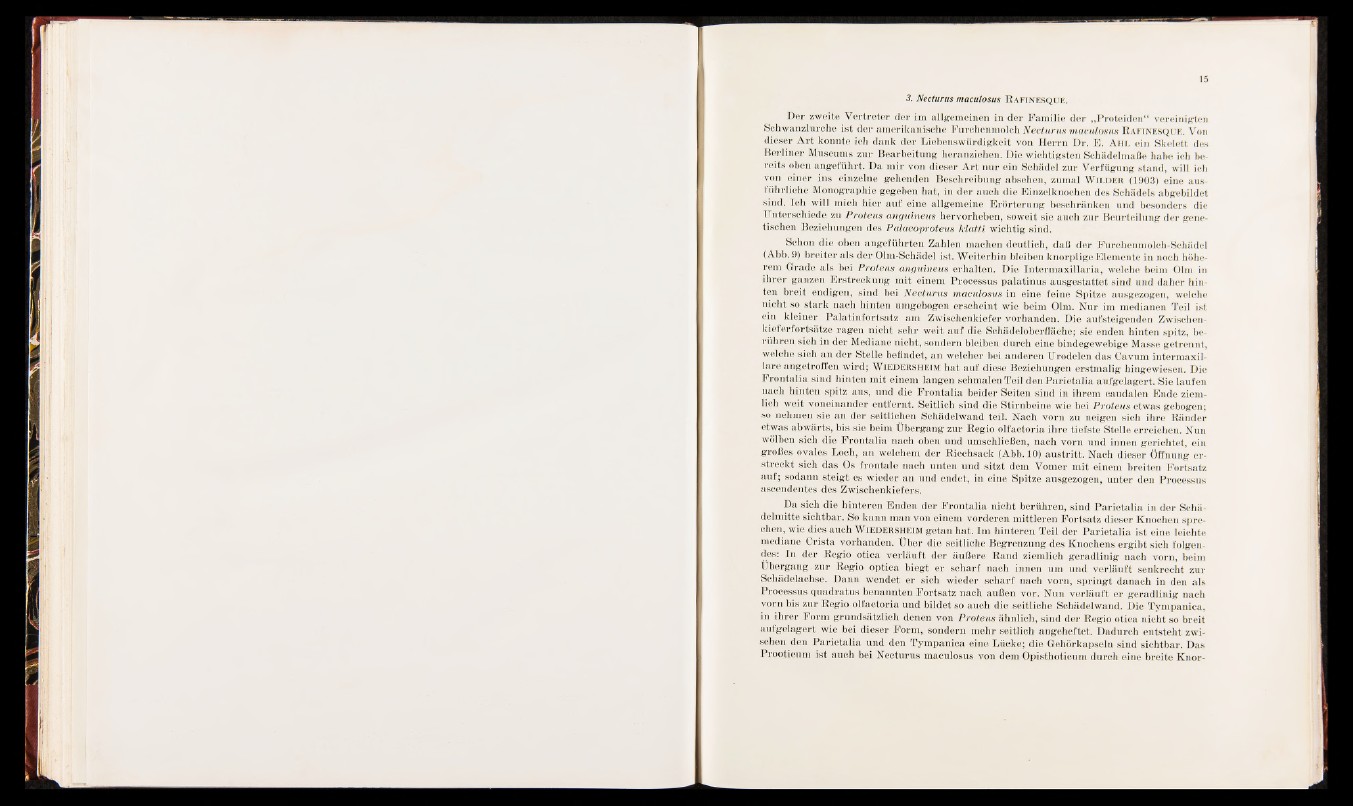
I
3. Necturus maculosus R a f in e s q u e .
Der zweite Vertreter der im allgemeinen in der Familie der „Proteiden“ vereinigten
Schwanzlurche ist der amerikanische Furchenmolch Necturus maculosus R a f i n e s q u e . Von
dieser Art konnte ich dank der Liebenswürdigkeit von Herrn Dr. E. A h l ein Skelett des
Berliner Museums zur Bearbeitung heranziehen. Die wichtigsten Schädelmaße habe ich bereits
oben angeführt. Da mir von dieser Art nur ein Schädel zur Verfügung stand, will ich
von einer ins einzelne gehenden Beschreibung absehen, zumal W i l d e r (1 9 0 3 ) eine ausführliche
Monographie gegeben hat, in der auch die Einzelknochen des Schädels abgebildet
sind. Ich will mich hier auf eine allgemeine Erörterung beschränken und besonders die
Unterschiede zu Proteus anguineus hervorheben, soweit sie auch zur Beurteilung der genetischen
Beziehungen des Palaeoproteus klatti wichtig sind.
Schon die oben angeführten Zahlen machen deutlich, daß der Furchenmolch-Schädel
(Abb. 9) breiter als der Olm-Schädel ist. Weiterhin bleiben knorplige Elemente in noch höherem
Grade als bei Proteus anguineus erhalten. Die Intermaxillaria, welche beim Olm in
ihrer ganzen Erstreckung mit einem Processus palatinus ausgestattet sind und daher hinten
breit endigen, sind bei Necturus maculosus in eine feine Spitze ausgezogen, welche
nicht so stark nach hinten umgebogen erscheint wie beim Olm. Nur im medianen Teil ist
ein kleiner Palatinfortsatz am Zwischenkiefer vorhanden. Die aufsteigenden Zwischenkieferfortsätze
ragen nicht sehr weit auf die Schädeloberfläche; sie enden hinten spitz, berühren
sich in der Mediane nicht, sondern bleiben durch eine bindegewebige Masse getrennt,
welche sich an der Stelle befindet, an welcher bei anderen Urodelen das Cavum intermaxillare
angetroffen wird; W ied e r sh e im hat auf diese Beziehungen erstmalig hingewiesen. Die
Frontalia sind hinten mit einem langen schmalen Teil den Parietalia aufgelagert. Sie laufen
nach hinten spitz aus, und die Frontalia beider Seiten sind in ihrem caudalen Ende ziemlich
weit voneinander entfernt. Seitlich sind die Stirnbeine wie bei Proteus etwas gebogen;
so nehmen sie an der seitlichen Schädelwand teil. Nach vorn zu neigen sich ihre Ränder
etwas abwärts, bis sie beim Übergang zur Regio olfactoria ihre tiefste Stelle erreichen. Nun
wölben sich die Frontalia nach oben und umschließen, nach vorn und innen gerichtet, ein
großes ovales Loch, an welchem der Riechsack (Abb. 10) austritt. Nach dieser Öffnung erstreckt
sich das Os frontale nach unten und sitzt dem Vomer mit einem breiten Fortsatz
auf; sodann steigt es wieder an und endet, in eine Spitze ausgezogen, unter den Processus
ascendentes des Zwischenkiefers.
Da sich die hinteren Enden der Frontalia nicht berühren, sind Parietalia in der Schädelmitte
sichtbar. So kann man von einem vorderen mittleren Fortsatz dieser Knochen sprechen,
wie dies auch W ied e r sh e im getan hat. Im hinteren Teil der Parietalia ist eine leichte
mediane Crista vorhanden. Über die seitliche Begrenzung des Knochens ergibt sich folgendes:
In der Regio otica verläuft der äußere Rand ziemlich geradlinig nach vorn, beim
Übergang zur Regio optica biegt er scharf nach innen um und verläuft senkrecht zur
Schädelachse. Dann wendet er sich wieder scharf nach vorn, springt danach in den als
Processus quadratus benannten Fortsatz nach außen vor. Nun verläuft er geradlinig nach
vorn bis zur Regio olfactoria und bildet so auch die seitliche Schädelwand. Die Tympanica,
in ihrer Form grundsätzlich denen von Proteus ähnlich, sind der Regio otica nicht so breit
aufgelagert wie bei dieser Form, sondern mehr seitlich angeheftet. Dadurch entsteht zwischen
den Parietalia und den Tympanica eine Lücke; die Gehörkapseln sind sichtbar. Das
Prooticum ist auch bei Necturus maculosus von dem Opisthoticum durch eine breite Knor