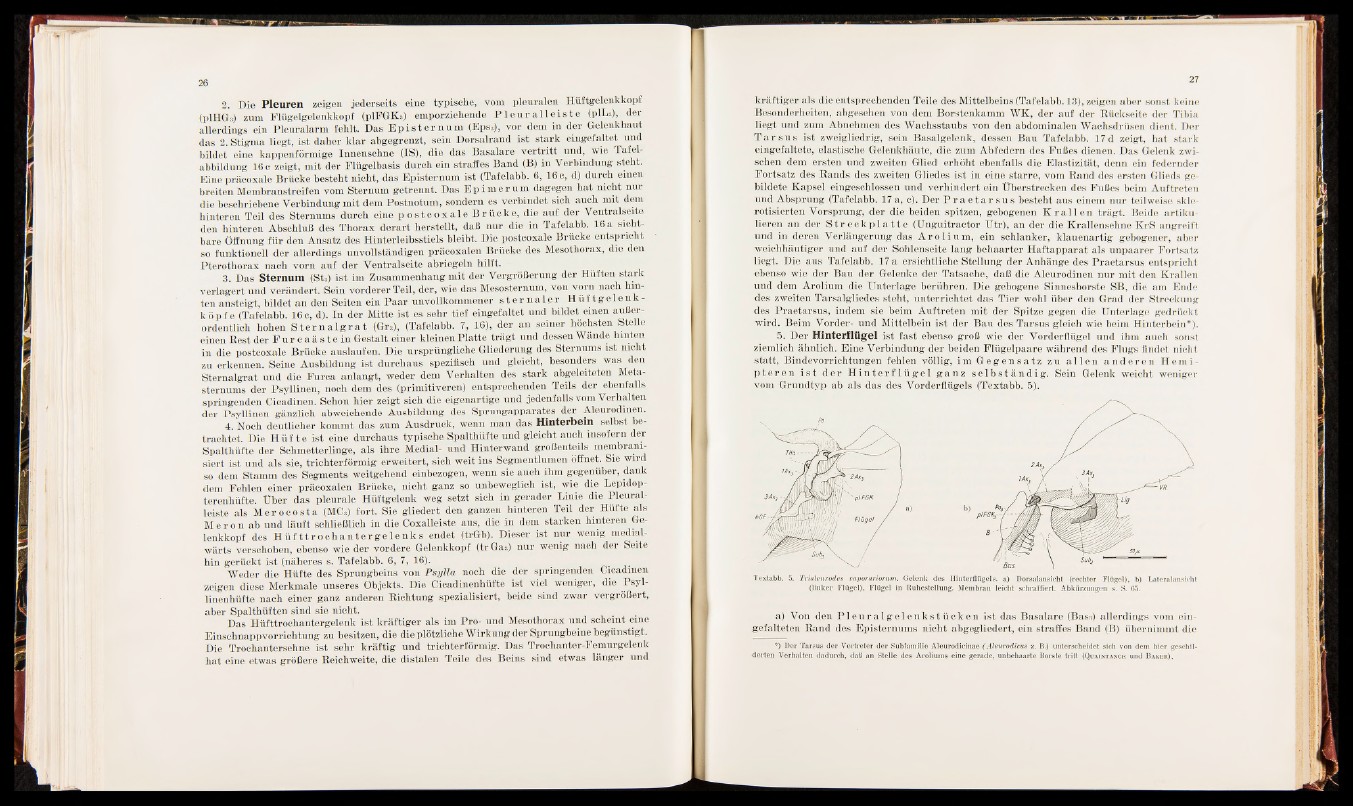
2. Die Pleuren zeigen jederseits eine typische, vom pleuralen Hüftgelenkkopf
(plHGs) zum Flügelgelenkkopf (plFGKs) emporziehende P l e u r a l l e i s t e (pll.a), der
allerdings ein Pleuralarm fehlt. Das E p i s t e r n u m (Epss), vor dem in der Gelenkhaut
das 2. Stigma liegt, ist daher klar abgegrenzt, sein Dorsalrand ist stark eingefaltet und
bildet eine kappenförmige Innensehne (IS), die das Basalare v e rtritt und, wie Tafelabbildung
16 e zeigt, mit der Flügelbasis durch ein straffes Band (B) in Verbindung steht.
Eine präcoxale Brücke besteht nicht, das Episternum ist (Tafelabb. 6, 16 c, d) durch einen
breiten Membranstreifen vom Sternum getrennt. Das E p im e r u m dagegen hat nicht nur
die beschriebene Verbindung mit dem Postnotum, sondern es verbindet sich auch mit dem
hinteren Teil des Sternums durch eine p o s f c o x a le Br ü c k e , die auf der Ventralseite
den hinteren Abschluß des Thorax derart herstellt, daß nur die in Tafelabb. 16 a sichtbare
Öffnung für den Ansatz des Hinterleibsstiels bleibt. Die postcoxale Brücke entspricht
so funktionell der allerdings unvollständigen präcoxalen Brücke des Mesothorax, die den
Pterothorax nach vorn auf der Ventralseite abriegeln hilft.
3. Das Sternum (Stä) ist im Zusammenhang m it der Vergrößerung der Hüften stark
verlagert und verändert. S ein vorderer Teil, der, wie das Mesosternum, von vorn nach hinten
ansteigt, bildet an den Seiten ein P a a r unvollkommener s t e r n a l e r H ü f t g e le n k -
k ö p f e (Tafelabb. 16 c, d). In der Mitte ist es sehr tief eingefaltet und bildet einen außerordentlich
hohen S t e r n a l g r a t (Grs), (Tafelabb. 7, 16), der an seiner höchsten Stelle
einen Best der F u r c a ä s t e i n Gestalt einer kleinen Platte träg t und dessen Wände hinten
in die postcoxale Brücke anslaufen. Die ursprüngliche Gliederung des Sternums ist nicht
zu erkennen. Seine Ausbildung ist durchaus spezifisch und gleicht, besonders was den
Sternalgrat und die Furca anlangt, weder dem Verhalten des stark abgeleiteten Metasternums
der Psyilinen, noch dem des (primitiveren) entsprechenden Teils der ebenfalls
springenden Cicadinen. Schon hier zeigt sich die eigenartige und jedenfalls vom Verhalten
der Psyilinen gänzlich abweichende Ausbildung des Sprungapparates der Aleurodmen.
4. Noch deutlicher kommt das zum Ausdruck, wenn man das Hinterbein selbst betrachtet.
Die H ü f t e ist eine durchaus typische Spalthüfte und gleicht auch insofern der
Spalthüfte der Schmetterlinge, als ihre Medial- und Hinterwand großenteils membrani-
siert ist und als sie, trichterförmig erweitert, sieh weit ins Segmentlumen öffipet. Sie wird
so dem Stamm des Segments weitgehend einbezogen, wenn sie auch ihm gegenüber, dank
dem Fehlen einer präcoxalen Brücke, nicht ganz so unbeweglich ist, wie die Lepidop-
terenhüfte. Uber das pleurale Hüftgelenk weg setzt sich in gerader Linie die PleuraL
leiste als Me r o c o s t a (MCe) fort. Sie gliedert den ganzen hinteren Teil der Hüfte als
M e r o n ab und läuft schließlich in die Coxalleiste aus, die in dem starken hinteren Gelenkkopf
des H ü f t t r o c h a n t e r g e l e n k s endet (trGb). Dieser ist nur wenig medi|V
wärts verschoben, ebenso wie der vordere Gelenkkopf (trGas) nur wenig nach der Seite
bin gerückt ist (näheres s. Tafelabb. 6, 7, 16).
Weder die Hüfte des Sprungbeins von Psytta noch die der springenden Cicadinen
zeigen diese Merkmale unseres Objekts. Die Cicadinenhüfte ist viel weniger, die Psyl-
linenhüfte nach einer ganz anderen Eichtung spezialisiert, beide sind zwar vergrößert,
aber Spalthüften sind sie nicht.
Das Hüfttrochantergelenk ist kräftiger als im Pro- und Mesothorax und scheint eine
Einsehnappvorrichtung zu besitzen, die die plötzliche Wirkung der Sprungbeine begünstigt.
Die Trochantersehne ist sehr kräftig und trichterförmig. Das Trochanter-Femurgelenk
hat eine etwas größere Reichweite, die distalen Teile des Beins sind etwas länger und
kräftiger als die entsprechenden Teile des Mittelbeins (Tafelabb. 13), zeigen aber sonst keine
Besonderheiten, abg esehen von dem Borstenkamm WK, der auf der Rückseite der Tibia
liegt und zum Abnehmen des Waehsstaubs von den abdominalen Wachsdrüsen dient. Der
T a r s u s ist zweigliedrig, sein Basalgelenk, dessen Bau Tafelabb. 17d zeigt, ha t stark
eingefaltete, elastische Gelenkhäute, die zum Abfedern des Fußes dienen. Das Gelenk zwischen
dem ersten und zweiten Glied erhöht ebenfalls die Elastizität, denn ein federnder
Fortsatz des Bands des zweiten Gliedes ist in eine starre, vom Band des ersten Glieds gebildete
Kapsel eingeschlossen und verhindert ein Überstrecken des Fußes beim Auftreten
und Absprung (Tafelabb. 17 a, c). Der P r a e t a r s u s besteht aus einem nur teilweise skle-
rotisierten Vorsprung, der die beiden spitzen, gebogenen K r a l l e n trägt. Beide a rtik u lieren
an der S t r | p k p l a 11 e (Unguitractor Utr), an der die Krallensehne KrS angreift
und in deren Verlängerung das A r o l i u m , ein schlanker, klauenartig gebogener, aber
weichhäutiger und auf der Sohlenseite lang behaarter Haftapparat als unpaarer Fortsatz
liegt. Die aus Tafelabb. 17 a ersichtliche Stellung der Anhänge des Praetarsus entspricht
ebenso wie der Bau der Gelenke der Tatsache, daß die Aleurodinen nur mit den Krallen
und dem Arolium die Unterlage berühren. Die gebogene Sinnesborste SB, die am Ende
des zweiten Tarsalgliedes steht, unterrichtet das Tie#' wohl über den Grad der Streckung
des Praetarsus, indem sie beim Auftreten mit der Spitze gegen die Unterlage gedrückt
wird. Beim Vorder- und Mittelbein ist der Bau des Tarsus gleich wie beim Hinterbein*).
5. Der Hinterfliigel ist fast ebenso groß wie der Vorderflügel und ihm auch sonst
ziemlich ähnlich. Eine Verbindung der beiden Flügelpaare während des Flugs findet nicht
Statt, Bindevorriehtungen fehlen tjjlig , im G e g e n s a zu a l l e n -5n d e r e n II c in i
p t e r e n i s t d e r H i n t e r f l ü g e l g a n z s e l b s t ä n d i g . Sein Gelenk weicht weniger
Vom Grundtyp ab als das des Vorderflügels (Textabb. 5)-. -
Textabb. ii. :l!.ria!eurodeb vaporariorum. Uelenk <les Hintcrlluüols. a) Dorsalansicht (rechter. jlLügel), b) Lateralansicht
(linker Flügel), Flügel in Ruhestellung. Membran leicht schraffiert. Abkürzungen s. S. 65.
a) Von den P l e u r a l g e l e n k s t ü c k e n ist das Basalare (Bass) allerdings vom eingefalteten
Rand des Episternums nicht abgegliedert, ein straffes Band (B) übernimmt die
*) Der Tarsus der Vertreter der Subfamilie Aleurodicinae (Äleurodicus z. B.) unterscheidet sich von dem hier geschilderten
Verhalten dadurch, daß an Stelle des Aroliums eine gerade, unbehaarte Borste tritt (Quaintance und Baker).