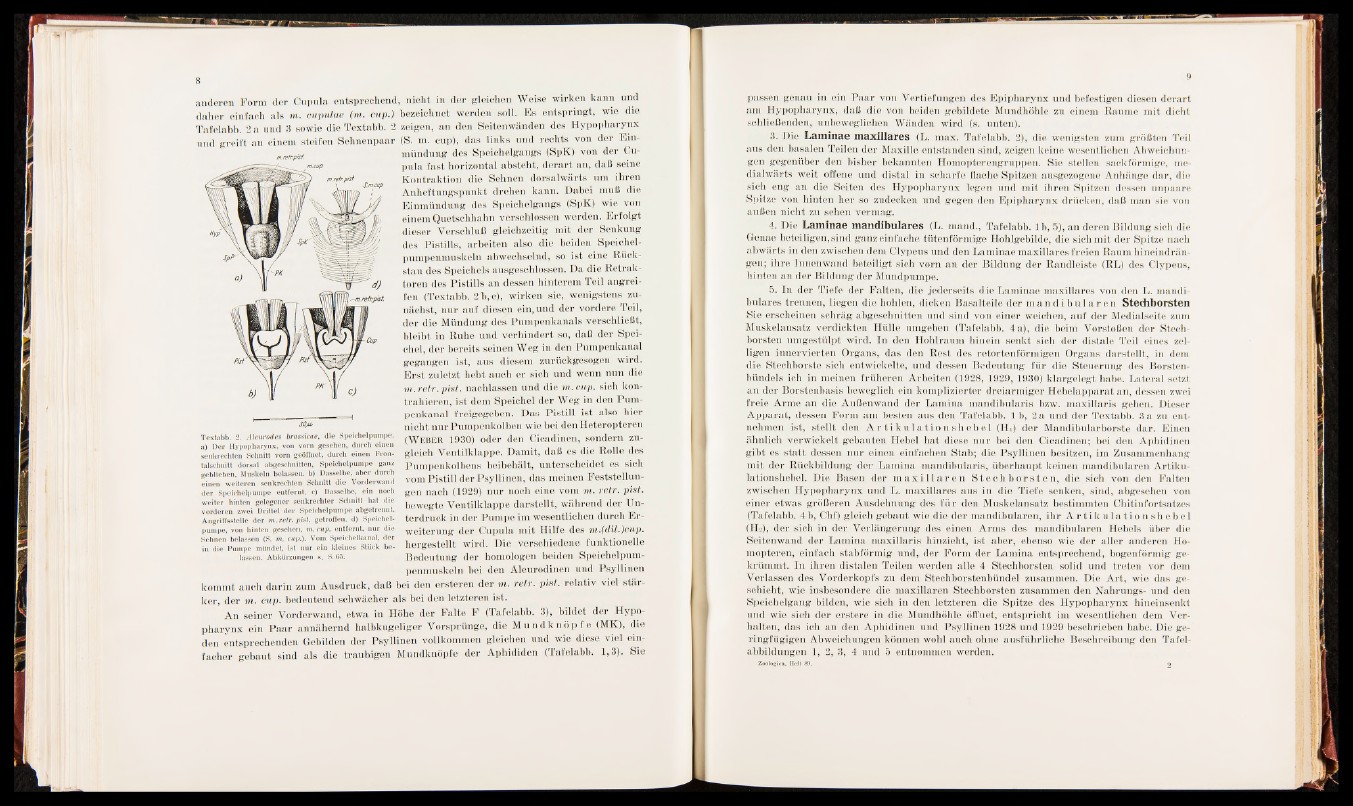
anderen Form der Cupula entsprechend, nicht in der gleichen Weise wirken kann und
daher einfach als m. cupulae (m. cup.) bezeichnet werden soll. Es entspringt, wie die
Tafelabb. 2 a und 3 sowie die Textabb. 2 zeigen, an den Seitenwänden des Hypopharynx
und greift an einem steifen Sehnenpaar (S. m. cup), das links und rechts von der Einmündung
des Speichelgangs (SpK) von der Cupula
fast horizontal absteht, derart an, daß seine
Kontraktion die Sehnen dorsalwärts um ihren
Anheftungspunkt drehen kann. Dabei muß die
Einmündung des Speichelgangs (SpK) wie von
einem Quetsehhahn verschlossen werden. Erfolgt
dieser Verschluß gleichzeitig mit der Senkung
des Pistills, arbeiten also die beiden Speiehelpumpenmuskeln
abwechselnd, so ist eine Rückstau
des Speichels ausgeschlossen. Da die Refraktoren
des Pistills an dessen hinterem Teil angreifen
(Textabb, 2 b, e), wirken sie, wenigstens zunächst,
nur auf diesen ein, und der vordere Teil,
der die Mündung des Pumpenkanals verschließt,
bleibt in Ruhe und verhindert so, daß der Speigi
ehel, der bereits seinen Weg in den Pumpenkanal
gegangen ist, aus diesem zurückgesogen wird.
Erst zuletzt hebt auch er sich und wenn nun die
m. retr. pist. nachlassen und die m. cup. sich kontrahieren,
ist dem Speichel der Weg in den Pumpenkanal
freigegeben. Das Pistill ist also hier
nicht nur Pumpenkolben wie hei denHeteropteren
rn.ntr.pist.
Textabb. 2. Alem-odes brmsicoe, d ie Speichelpumpe. ( \ y E B E R 1 9 3 0 ) oder den Cicadinen, sondern zuse
n k i^ e c h ten °S ^n uT v o rn geöttaet, d urch einen F ro n - gleich Ventilklappe. Damit, daß es die Rolle des
talschnitt dorsal abgeschnitten, Speichelpumpe gans p umpenkolbens beibehält, unterscheidet es sieh
l“ ;teMr«“ cMeen ■ » ■ ■ vom Pistill der Psyllinen, das meinen Feststellun-
d e r Speichelpumpe entfe rnt, c) Dasselbe, ein noch gen nach (1929) nur noch eine vom m. retr. pist.
w e ite r h inten gelegener senkrechte r Schnitt h a t d ie Ventilklappe darstellt, während der Unvo
rd e ren zwei Drittel d e r Speichelpumpe abgetrennt, » .
Angriffssteile d e r m. retr. pist. getroffen, d) Speichel- terdruck in der Pumpe im wesentlichen durcn ü-r-
pumpe, von hinten gesehen, m. cup. entfe rnt, n u r d ie weiterung der Cupula mit Hilfe des m.(dll.)cup.
w m m m m m m m m m m m m k hergestellt wird. Die verschiedene funktionelle
lassen. Abkürzungen s. s. 65. Bedeutung der homologen beiden Speichelpumpenmuskeln
bei den Aleurodinen und Psyllinen
kommt auch darin zum Ausdruck, daß hei den ersteren der m. retr. pist. relativ viel stärker,
der m. cup. bedeutend schwächer als hei den letzteren ist.
An seiner Vorderwand, etwa in Höhe der Falte F (Tafelabb. 3), bildet der Hypopharynx
ein P a a r annähernd halbkugeliger Vorsprünge, die Mu n d k n ö p f e (MK), die
den entsprechenden Gebilden der Psyllinen vollkommen gleichen und wie diese viel einfacher
gebaut sind als die traubigen Mundknöpfe der Aphididen (Tafelabb. 1,3). Sie
passen genau in ein P a a r von Vertiefungen des Epipharynx und befestigen diesen derart
am Hypopharynx, daß die von beiden gebildete Mundhöhle zu einem Raume mit dicht
schließenden, unbeweglichen Wänden wird (s. unten).
3. Die L am inae inax illa res (L. max. Tafelabb. 2), die wenigsten zum größten Teil
aus den basalen Teilen der Maxille entstanden sind, zeigen keine wesentlichen Abweichungen
gegenüber den bisher bekannten Homopterengruppen. Sie stellen sackförmige, me-
dialwärts weit offene und distal in scharfe flache Spitzen ausgezogene Anhänge dar, die
sich eng an die Seiten des Hypopharynx legen und mit ihren Spitzen dessen unpaare
Spitze von hinten her so zudecken und gegen den Epipharynx drücken, daß man sie von
außen nicht zu sehen vermag.
4. Die Laminae mandibulares (L. mand., Tafelabb. lb , 5), an deren Bildung sich die
Genae beteiligen, sind ganz einfache tütenförmige Hohlgebilde, die sich mit der Spitze nach
abwärts in den zwischen dem Clypeus und den Laminae maxillares freien Raum hineindrängen;
ihre Innenwand beteiligt sich vorn an der Bildung der Randleiste (RL) des Clypeus,
hinten an der Bildung der Mundpumpe.
5. In der Tiefe der Falten, die jederseits die Laminae maxillares von den L. mandibulares
trennen, liegen die hohlen, dicken Basalteile der m a n d i b u l a r e n Stechborsten
Sie erscheinen schräg abgeschnitten und sind von einer weichen, auf der Medialseite zum
Muskelansatz verdickten Hülle umgeben (Tafelabb. 4 a), die beim Vor stoßen der Stechborsten
umgestülpt wird. In den Hohlraum hinein senkt sich der distale Teil eines zel-
ligen innervierten Organs, das den Rest des retortenförmigen Organs darstellt, in dem
die Stechborste sich entwickelte, und dessen Bedeutung für die Steuerung des Borstenbündels
ich in meinen früheren Arbeiten (1928, 1929, 1930) klargelegt habe. Lateral setzt
an der Borstenbasis beweglich ein komplizierter dreiarmiger Hebelapparat an, dessen zwei
freie Arme an die Außenwand der Lamina mandibularis bzw. maxillaris gehen. Dieser
Apparat, dessen Form am besten aus den Tafelabb. 1 b, 2 a und der Textabb. 3 a zu entnehmen
ist, stellt den A r t i k u l a t i o n s h e b e l (IL) der Mandibularborste dar. Einen
ähnlich verwickelt gebauten Hebel hat diese n ur bei den Cicadinen; bei den Aphidinen
gibt es sta tt dessen nur einen einfachen Stab; die Psyllinen besitzen, im Zusammenhang
mit der Rückbildung der Lamina mandibularis, überhaupt keinen mandibularen Artikulationshebel.
Die Basen der m a x i l l a r e n S t e c h b o r s t e n , die sich von den Falten
zwischen Hypopharynx und L. maxillares aus in die Tiefe senken, sind, abgesehen von
einer etwas größeren Ausdehnung des fü r den Muskelansatz bestimmten Chitinfortsatzes
(Tafelabb. 4 b, Chf) gleich gebaut wie die der mandibularen, ihr A r t i k u l a t i o n s h e b e l
(H2), der sich in der Verlängerung des einen Arms des mandibularen Hebels über die
Seitenwand der Lamina maxillaris hinzieht, ist aber, ebenso wie der aller anderen Ho-
mopteren, einfach stabförmig und, der Form der Lamina entsprechend, bogenförmig gekrümmt.
In ihren distalen Teilen werden alle 4 Stechborsten solid und treten vor dem
Verlassen des Vorderkopfs zu dem Stechborstenbündel zusammen. Die Art, wie das geschieht,
wie insbesondere die maxillaren Stechborsten zusammen den Nahrungs- und den
Speichelgang bilden, wie sich in den letzteren die Spitze des Hypopharynx hineinsenkt
und wie sich der erstere in die Mundhöhle öffnet, entspricht im wesentlichen dem Verhalten,
das ich an den Aphidinen und Psyllinen 1928 und 1929 beschrieben habe. Die geringfügigen
Abweichungen können wohl auch ohne ausführliche Beschreibung den Tafelabbildungen
1, 2, 3, 4 und 5 entnommen werden.
Zoologica, Heft 89. 2