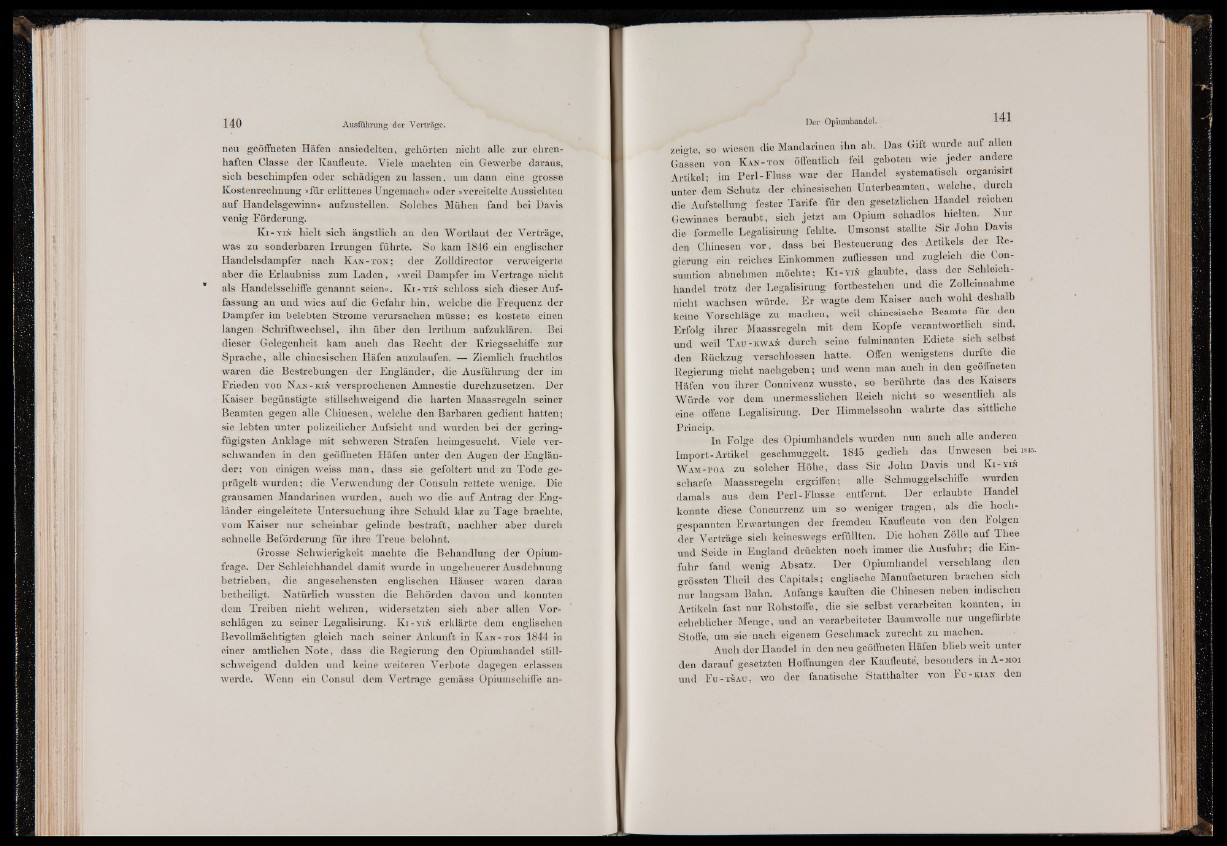
neu geöffneten Häfen ansiedelten, gehörten nicht alle zur ehrenhaften
Classe der Kaufleute. Viele machten ein Gewerbe daraus,
sich beschimpfen oder schädigen zu lassen, um dann eine grosse
Kostenrechnung »für erlittenes Ungemach« oder »vereitelte Aussichten
auf Handelsgewinn« aufzustellen. Solches Mühen fand hei Davis
venig Förderung.
Ki - y in hielt sich ängstlich an den Wortlaut der Verträge,
was zu sonderbaren Irrungen führte. So kam 1846 ein englischer
Handelsdampfer nach K a n - t o n ; der Zolldirector verweigerte
aber die Erlaubniss zum Laden, »weil Dampfer im Vertrage nicht
als Handelsschiffe genannt seien«. K i - y in schloss sich dieser Auffassung
an und wies auf die Gefahr hin, welche die Frequenz der
Dampfer im belebten Strome verursachen müsse; es kostete einen
langen Schriftwechsel, ihn über den Irrtlium aufzuklären. Bei
dieser Gelegenheit kam auch das Recht der Kriegsschiffe zur
Sprache, alle chinesischen Häfen anzulaufen. Ziemlich fruchtlos
waren die Bestrebungen der Engländer, die Ausführung der im
Frieden von N a n - k in versprochenen Amnestie durchzusetzen. Der
Kaiser begünstigte stillschweigend die harten Maassregeln seiner
Beamten gegen alle Chinesen, welche den Barbaren gedient hatten;
sie lebten unter polizeilicher Aufsicht und wurden bei der geringfügigsten
Anklage mit schweren Strafen heimgesucht. Viele verschwanden
in den geöffneten Häfen unter den Augen der Engländer;
von einigen weiss man, dass sie gefoltert und zu Tode geprügelt
wurden; die Verwendung der Consuln rettete wenige. Die
grausamen Mandarinen wurden, auch wo die auf Antrag der Engländer
eingeleitete Untersuchung ihre Schuld klar zu Tage brachte,
vom Kaiser nur scheinbar gelinde bestraft, nachher aber durch
schnelle Beförderung für ihre Treue belohnt.
Grosse Schwierigkeit machte die Behandlung der Opiumfrage.
Der Schleichhandel damit wurde in ungeheuerer Ausdehnung
betrieben, die angesehensten englischen Häuser waren daran
hetheiligt. Natürlich wussten die Behörden davon und konnten
dem Treiben nicht wehren, widersetzten sich aber allen Vorschlägen
zu seiner Legalisirung. K i - y in erklärte dem englischen
Bevollmächtigten gleich nach seiner Ankunft in K a n - t o n 1844 in
einer amtlichen Note, dass die Regierung den Opiumhandel stillschweigend
dulden und keine weiteren Verbote dagegen erlassen
werde. Wenn ein Consul dem Vertrage gemäss Opiumschifte anzeigte,
so wiesen die Mandarinen ihn ab. Das Gift wurde auf allen
Gassen von K a n - t o n öffentlich feil geboten wie jeder andere
Artikel; im Perl-Fluss war der Handel systematisch organisirt
unter dem Schutz der chinesischen Unterbeamten, welche, durch
die Aufstellung fester Tarife für den gesetzlichen Handel reichen
Gewinnes beraubt, sich jetzt am Opium schadlos hielten. Nur
die formelle Legalisirung fehlte. Umsonst stellte Sir John Davis
den Chinesen vor, dass bei Besteuerung des Artikels der Regierung
ein reiches Einkommen zufliessen und zugleich die Con-
sumtion abnehmen möchte; K i - y in glaubte, dass der Schleichhandel
trotz der Legalisirung fortbestehen und die Zolleinnahme
nicht wachsen würde. Er wagte dem Kaiser auch wohl deshalb
keine Vorschläge zu machen, weil chinesische Beamte für den
Erfolg ihrer Maassregeln mit dem Kopfe verantwortlich sind,
und weil T a u - k w a ñ durch seine fulminanten Edicte sich selbst
den Rückzug verschlossen hatte. Offen wenigstens durfte die
Regierung nicht nachgeben; und wenn man auch in den geöflneten
Häfen von ihrer Connivenz wusste, so berührte das des Kaisers
Würde vor dem unermesslichen Reich nicht so wesentlich als
eine offene Legalisirung. Der Himmelssohn wahrte das sittliche
Princip.
In Folge des Opiumhandels wurden nun auch alle anderen
Import-Artikel geschmuggelt. 1845 gedieh das Unwesen bei 1845.
W a m - p o a z u solcher Höhe, dass Sir John Davis und K i - y in
scharfe Maassregeln ergriffen; alle Schmuggelschiffe wurden
damals aus dem Perl-Flusse entfernt. Der erlaubte Handel
konnte diese Concurrenz um so weniger tragen, als die hochgespannten
Erwartungen der fremden Kaufleute von den I olgen
der Verträge sich keineswegs erfüllten. Die hohen Zölle auf Thee
und Seide in England drückten noch immer die Ausfuhr; die Einfuhr
fand wenig Absatz. Der Opiumhandel verschlang den
grössten Theil des Capitals; englische Manufacturen brachen sich
nur langsam Bahn. Anfangs kauften die Chinesen neben indischen
Artikeln fast nur Rohstoffe, die sie selbst verarbeiten konnten, in
erheblicher Menge, und an verarbeiteter Baumwolle nur ungefärbte
Stoffe, um sie nach eigenem Geschmack zurecht zu machen.
Auch der Handel in den neu geöffneten Häfen blieb weit unter
den darauf gesetzten Hoffnungen der Kaufleute, besonders in A - m o i
und F u - t s a u , w o der fanatische Statthalter von F u - k ia n den