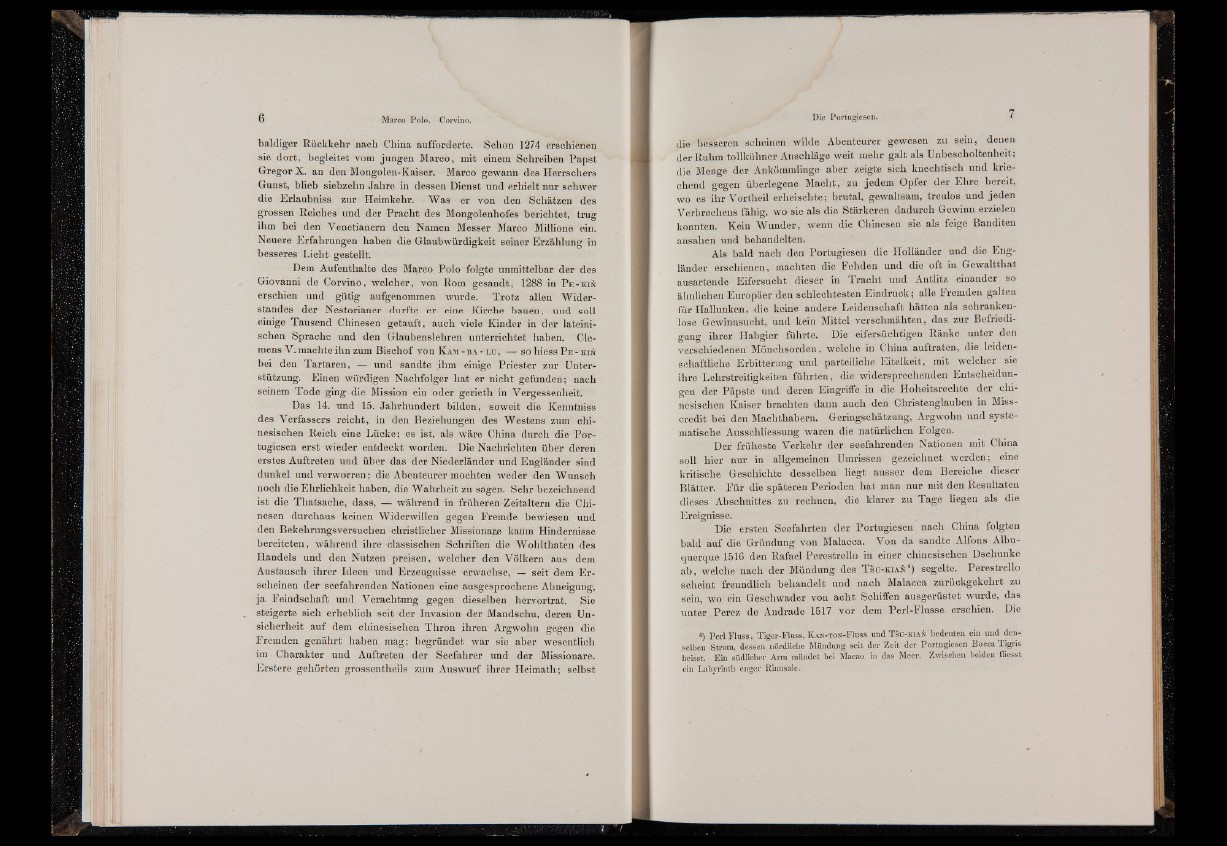
6 Marco Polo. Corvino.
baldiger Rückkehr nach China aufforderte. Schon 1274 erschienen
sie dort, begleitet vom jungen Marco, mit einem Schreiben Papst
Gregor X. an den Mongolen-Kaiser. Marco gewann des Herrschers
Gunst, blieb siebzehn Jahre in dessen Dienst und erhielt nur schwer
die Erlaubniss zur Heimkehr. Was er von den Schätzen des
grossen Reiches und der Pracht des Mongolenhofes berichtet, trug
ihm bei den Venetianern den Namen Messer Marco Millione ein.
Neuere Erfahrungen haben die Glaubwürdigkeit seiner Erzählung in
besseres Licht gestellt.
Dem Aufenthalte des Marco Polo folgte unmittelbar der des
Giovanni de Corvino, welcher, von Rom gesandt, 1288 in P e - k i n
erschien und gütig aufgenommen wurde. Trotz allen Widerstandes
der Nestorianer durfte er eine Kirche hauen, und soll
einige Tausend Chinesen getauft, auch viele Kinder in der lateinischen
Sprache und den Glaubenslehren unterrichtet haben. Clemens
V. machte ihn zum Bischof von K a m - b ä - l u , — so hiess P e - k in
bei den Tartaren, — und sandte ihm einige Priester zur Unterstützung.
Einen würdigen Nachfolger hat er nicht gefunden; nach
seinem Tode ging die Mission ein oder gerieth in Vergessenheit.
Das 14. und 15. Jahrhundert bilden, soweit die Kenntniss
des Verfassers reicht, in den Beziehungen des Westens zum chinesischen
Reich eine Lücke; es ist, als wäre China durch die Portugiesen
erst wieder entdeckt worden. Die Nachrichten über deren
erstes Auftreten und über das der Niederländer und Engländer sind
dunkel und verworren; die Abenteurer mochten weder den Wunsch
noch die Ehrlichkeit haben, die Wahrheit zu sagen. Sehr bezeichnend
ist die Thatsache, dass, — während in früheren Zeitaltern die Chinesen
durchaus keinen Widerwillen gegen Fremde bewiesen und
den Bekehrungsversuchen christlicher Missionare kaum Hindernisse
bereiteten, während ihre classischen Schriften die Wohlthaten des
Handels und den Nutzen preisen, welcher den Völkern aus dem
Austausch ihrer Ideen und Erzeugnisse erwachse, — seit dem Erscheinen
der seefahrenden Nationen eine ausgesprochene Abneigung,
ja Feindschaft und Verachtung gegen dieselben hervortrat. Sie
steigerte sich erheblich seit der Invasion der Mandschu, deren Unsicherheit
auf dem chinesischen Thron ihren Argwohn gegen die
Fremden genährt haben mag; begründet war sie aber wesentlich
im Charakter und Auftreten der Seefahrer und der Missionare.
Erstere gehörten grossentlieils zum Auswurf ihrer Ileimath; selbst
Die Portugiesen. 7
die besseren scheinen wilde Abenteurer gewesen zu sein, denen
der Ruhm tollkühner Anschläge weit mehr galt als Unbescholtenheit;
die Menge der Ankömmlinge aber zeigte siel; knechtisch und kriechend
gegen überlegene Macht, zu jedem Opfer der Ehre bereit,
wo es ihr Vortheil erheischte; brutal, gewaltsam, treulos und jeden
Verbrechens fähig, wo sie als die Stärkeren dadurch Gewinn erzielen
konnten. Kein Wunder, wenn die Chinesen sie als feige Banditen
ausahen und behandelten.
Als bald nach den Portugiesen die Holländer und die Engländer
erschienen, machten die Fehden und die oft in Gewaltthat
ausartende Eifersucht dieser in Tracht und Antlitz einander so
ähnlichen Europäer den schlechtesten Eindruck; alle Iremden galten
für Hallunken, die keine andere Leidenschaft hätten als schrankenlose
Gewinnsucht, und kein Mittel verschmähten, das zur Befriedigung
ihrer Habgier führte. Die eifersüchtigen Ränke unter den
verschiedenen Mönchsorden, welche in China aultraten, die leidenschaftliche
Erbitterung und parteiliche Eitelkeit, mit welcher sie
ihre Lehrstreitigkeiten führten, die widersprechenden Entscheidungen
der Päpste und deren Eingrille in die Hoheitsrechte der chinesischen
Kaiser brachten dann auch den Christenglauben in Miss-
credit bei den Machthabern. Geringschätzung, Argwohn und systematische
Ausschliessung waren die natürlichen Folgen.
Der früheste Verkehr der seefahrenden Nationen mit China
soll hier nur in allgemeinen Umrissen gezeichnet werden; eine
kritische Geschichte desselben liegt ausser dem Bereiche dieser
Blätter. Für die späteren Perioden hat man nur mit den Resultaten
dieses Abschnittes zu rechnen, die klarer zu Tage liegen als die
Ereignisse.
Die ersten Seefahrten der Portugiesen nach China folgten
bald auf die Gründung von Malacca. Von da sandte Alfons Albu-
querque 1516 den Rafael Perestrello in einer chinesischen Dschunke
ab, welche nach der Mündung des T su-kian1) segelte. Perestrello
scheint freundlich behandelt und nach Malacca zurückgekehrt zu
sein, wo ein Geschwader von acht Schiffen ausgerüstet wurde, das
unter Perez de Andrade 1517 vor dem Perl-Flusse erschien. Die
4) Perl Fluss, Tiger-Fluss, K a n - t o n - F I u s s und T s u - k ia n ' bedeuten ein und denselben
Strom, dessen nördliche Mündung seit der Zeit der Portugiesen Bocca Tigris
heisst. Ein südlicher Arm mündet bei Macao in das Meer. Zwischen beiden fliesst
ein Labyrinth enger Rinnsale.