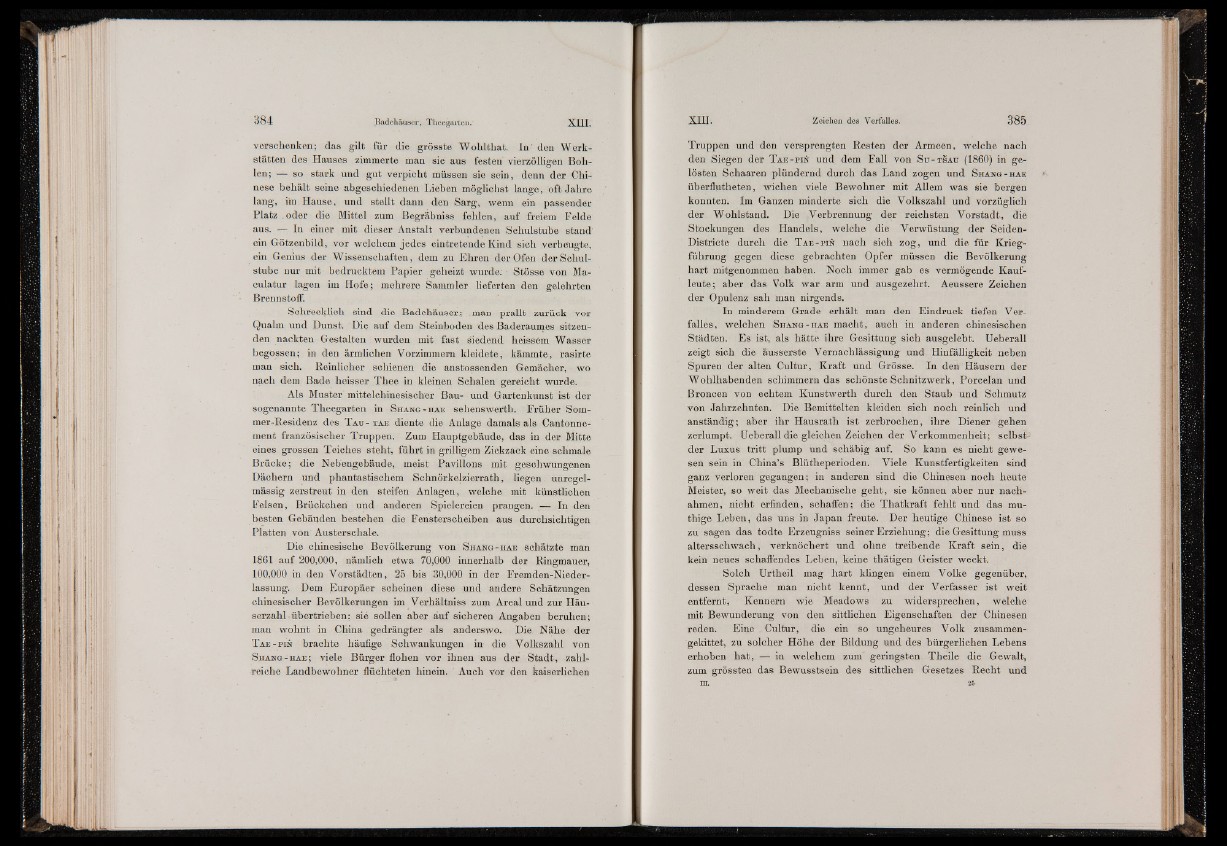
verschenken; das gilt für die grösste Wohltliat. In' den Werkstätten
des Hauses zimmerte man sie aus festen vierzölligen Bohlen;
— so stark und gut verpicht müssen sie sein, denn der Chinese
behält seine abgeschiedenen Lieben möglichst lange, oft Jahre
lang, im Hause, und stellt dann den Sarg, wenn ein passender
Platz .oder die Mittel zum Begräbniss fehlen, auf freiem Felde
aus. —; In einer mit dieser Anstalt verbundenen Schulstube stand'
ein Götzenbild, vor welchem jedes eintretende Kind sich verbeugte,
ein Genius der Wissenschaften, dem zu Ehren der Ofen der Schulstube
nur mit bedrucktem Papier geheizt wurde; Stösse von Ma-
culatur lagen im Hofe; mehrere Sammler lieferten den gelehrten
Brennstoff.
Schrecklich sind die Badehäuser; man prallt zurück vor
Qualm und Dunst. Die auf dem Steinboden des Baderaumes sitzenden
nackten Gestalten wurden mit fast siedend heissem Wasser
begossen; in den ärmlichen Vorzimmern kleidete, kämmte, rasirte
man sich. Reinlicher schienen die anstossenden Gemächer, wo
nach dem Bade heisser Thee in kleinen Schalen gereicht wurde.
Als Muster mittelchinesischer Bau- und Gartenkunst ist der
sogenannte Theegarten in S h a n g - h a e sehensw-erth. Früher Sommer
Residenz des T a u - t a e diente die Anlage damals als Cantonne-
ment französischer Truppen. Zum Hauptgebäude, das in der Mitte
eines grossen Teiches steht, führt in grilligem Zickzack eine schmale
Brücke; die Nebengebäude, meist Pavillons mit geschwungenen
Dächern und phantastischem Schnörkelzierrath, liegen unregelmässig
zerstreut in den steifen Anlagen, welche mit künstlichen
Felsen, Brückchen und anderen Spielereien prangen. — In den
besten Gebäuden bestehen die Fensterscheiben aus durchsichtigen
Platten von Austerschale.
Die chinesische Bevölkerung von S h a n g - h a e schätzte man
1861 auf 200,000, nämlich etwa 70,000 innerhalb der Ringmauer,
100,000 in den Vorstädten, 25 bis 30,000 in der Fremden-Nieder-
lassung. Dem Europäer scheinen diese und andere Schätzungen
chinesischer Bevölkerungen im Verhältniss zum Areal und zur Häuserzahl
übertrieben; sie sollen aber auf sicheren Angaben beruhen;
man wohnt in China gedrängter als anderswo. Die Nähe der
T a e - P in brachte häufige Schwankungen in die Volkszahl von
S h a n g - h a e ; viele Bürger flohen vor ihnen aus der Stadt, zahlreiche
Landbewohner flüchteten hinein. Auch vor den kaiserlichen
Truppen und den versprengten Resten der Armeen, welche nach
den Siegen der T a e - p in und dem Fall von S u - t s a u (1860) in gelösten
Schaaren plündernd durch das Land zogen und S h a n g - h a e
überflutheten, wichen viele Bewohner mit Allem was sie bergen
konnten. Im Ganzen minderte sich die Volkszahl und vorzüglich
der Wohlstand. Die Verbrennung der reichsten Vorstadt, die
Stockungen des Handels, welche die Verwüstung der Seiden-
Districte durch die T a e - p in nach sich zog, und die für Kriegführung
gegen diese gebrachten Opfer müssen die Bevölkerung
hart mitgenommen haben. Noch immer gab es vermögende Kaufleute;
aber das Volk war arm und ausgezehrt. Aeussere Zeichen
der Opulenz sah man nirgends.
In minderem Grade erhält man den Eindruck tiefen Verfalles,
welchen S h a n g - h a e macht, auch in anderen chinesischen
Städten. Es ist, als hätte ihre Gesittung sich ausgelebt. Ueberall
zeigt sich die äusserste Vernachlässigung und Hinfälligkeit neben
Spuren der alten Cultur, Kraft und Grösse. In den Häusern der
Wohlhabenden schimmern das schönste Schnitzwerk, Porcelan und
Broncen von echtem Kunstwerth durch den Staub und Schmutz
von Jahrzehnten. Die Bemittelten kleiden sich noch reinlich und
anständig; aber ihr Hausrath ist zerbrochen, ihre Diener gehen
zerlumpt. Ueberall die gleichen Zeichen der Verkommenheit; selbst
der Luxus tritt plump und schäbig auf. So kann es nicht gewesen
sein in China’s Blütheperioden. Viele Kunstfertigkeiten sind
ganz verloren gegangen; in anderen sind die Chinesen noch heute
Meister, so weit das Mechanische geht, sie können aber nur nachahmen,
nicht erfinden, schaffen; die Thatkraft fehlt und das mu-
thige Leben, das uns in Japan freute. Der heutige Chinese ist so
zu sagen das todte Erzeugniss seiner Erziehung; die Gesittung muss
altersschwach, verknöchert und ohne treibende Kraft sein, die
kein neues schaffendes Leben, keine thätigen Geister weckt.
Solch Urtheil mag hart klingen einem Volke gegenüber,
dessen Sprache man nicht kennt, und der Verfasser ist weit
entfernt, Kennern wie Meadows zu widersprechen, welche
mit Bewunderung von den sittlichen Eigenschaften der Chinesen
reden. Eine Cultur, die ein so ungeheures Volk zusammengekittet,
zu solcher Höhe der Bildung und des bürgerlichen Lebens
erhoben hat, — in welchem zum geringsten Theile die Gewalt,
zum grössten das Bewusstsein des sittlichen Gesetzes Recht und
m . 25