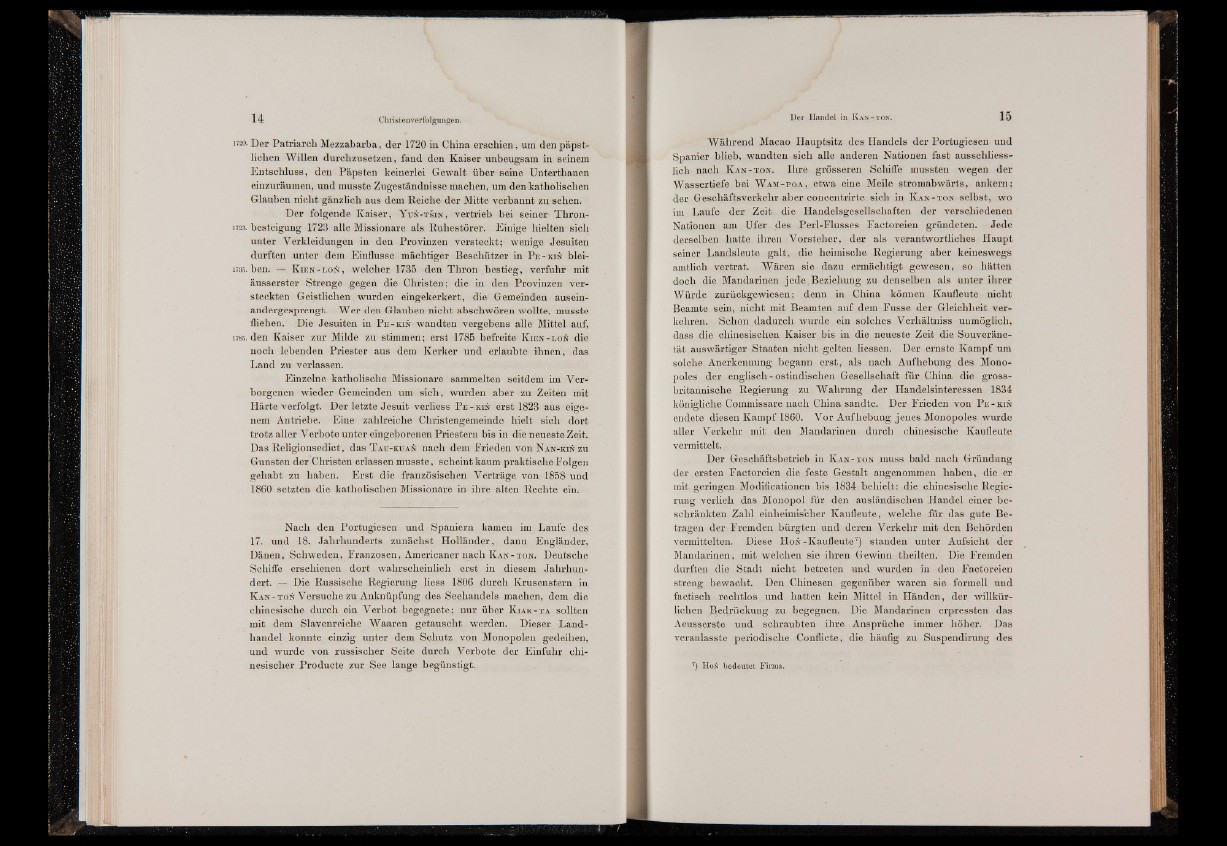
14 Christenverfolgungen.
1720. Der Patriarch Mezzabarba, der 1720 in China erschien, um den päpstlichen
Willen durchzusetzen, fand den Kaiser unbeugsam in seinem
Entschluss, den Päpsten keinerlei Gewalt über seine Unterthanen
einzuräumen, und musste Zugeständnisse machen, um den katholischen
Glauben nicht gänzlich aus dem Reiche der Mitte verbannt zu sehen.
Der folgende Kaiser, Y u n - t s i n , vertrieb bei seiner Thron-
1723. besteigung 1723 alle Missionare als Ruhestörer. Einige hielten sich
unter Verkleidungen in den Provinzen versteckt; wenige Jesuiten
durften unter dem Einflüsse mächtiger Beschützer in P e - k in blei-
1735. ben. — K ie n - lo n , welcher, 1735 den Thron bestieg, verfuhr mit
äusserster Strenge gegen die Christen; die in den Provinzen versteckten
Geistlichen wurden eingekerkert, die Gemeinden auseinandergesprengt.
Wer den Glauben nicht abschwören wollte, musste
fliehen. Die Jesuiten in P e - k in wandten vergebens alle Mittel auf,
1785. den Kaiser zur Milde zu stimmen; erst 1785 befreite K i e n - lo n die
noch lebenden Priester aus dem Kerker und erlaubte ihnen, das
Land zu verlassen.
Einzelne katholische Missionare sammelten seitdem im Verborgenen
wieder Gemeinden um sich, wurden aber zu Zeiten mit
Plärte verfolgt. Der letzte Jesuit verliess P e - k in erst 1823 aus eigenem
Antriebe. Eine zahlreiche Christengemeinde hielt sich dort
trotz aller Verbote unter eingeborenen Priestern bis in die neueste Zeit.
Das Religionsedict, das T a u -k u a n nach dem Frieden von N a n -k in z u
Gunsten der Christen erlassen musste, scheint kaum praktische Folgen
gehabt zu haben. Erst die französischen Verträge von 1858 und
1860 setzten die katholischen Missionare in ihre alten Rechte ein.
Nach den Portugiesen und Spaniern kamen im Laufe des
17. und 18. Jahrhunderts zunächst Holländer, dann Engländer,
Dänen, Schweden, Franzosen, Americaner nach K a n - t o n . Deutsche
Schiffe erschienen dort wahrscheinlich erst in diesem Jahrhundert.
¡g? Die Russische Regierung liess 1806 durch Krusenstern in
K a n - to n Versuche zu Anknüpfung des Seehandels machen, dem die
chinesische durch ein Verbot begegnete; nur über K i a k - t a sollten
mit dem Slavenreiche Waaren getauscht werden. Dieser Landhandel
konnte einzig unter dem Schutz von Monopolen gedeihen,
und wurde von russischer Seite durch Verbote der Einfuhr chinesischer
Producte zur See lange begünstigt.
Der Handel in K a n - t o n . 15
Während Macao Hauptsitz des Handels der Portugiesen und
Spanier blieb, wandten sich alle anderen Nationen fast ausschliesslich
nach K a n - t o n . Ihre grösseren Schiffe mussten wegen der
Wassertiefe bei W a m - p o a , etwa eine Meile stromabwärts, ankern;
der Geschäftsverkehr aber concentrirte sich in K a n - to n selbst, wo
im Laufe der Zeit die Handelsgesellschaften der verschiedenen
Nationen am Ufer des Perl-Flusses Factoreien gründeten. Jede
derselben hatte ihren Vorsteher, der als verantwortliches Haupt
seiner Landsleute galt, die heimische Regierung aber keineswegs
amtlich vertrat. Wären sie dazu ermächtigt gewesen, so hätten
doch die Mandarinen jede Beziehung zu denselben als unter ihrer
Würde zurückgewiesen; denn in China können Kaufleute nicht
Beamte sein, nicht mit Beamten auf dem Fusse der Gleichheit verkehren.
Schon dadurch wurde ein solches Verhältniss unmöglich,
dass die chinesischen Kaiser bis in die neueste Zeit die Souveräne-
tät auswärtiger Staaten nicht gelten Hessen. Der ernste Kampf um
solche Anerkennung begann erst, als nach Aufhebung des Mono-
poles der englisch - ostindischen Gesellschaft für China die grossbritannische
Regierung zu Wahrung der Handelsinteressen 1834
königliche Commissare nach China sandte. Der Frieden von P e - k in
endete diesen Kampf 1860. Vor Aufhebung jenes Monopoles wurde
aller Verkehr mit den Mandarinen durch chinesische Kaufleute
vermittelt.
Der Geschäftsbetrieb in K a n - to n muss bald nach Gründung
der ersten Factoreien die feste Gestalt angenommen haben, die er
mit geringen Modificationen bis 1834 behielt: die chinesische Regierung
verlieh das Monopol für den ausländischen Handel einer beschränkten
Zahl einheimischer Kaufleute, welche für das gute Betragen
der Fremden bürgten und deren Verkehr mit den Behörden
vermittelten. Diese H o n -Kaufleute7) standen unter Aufsicht der
Mandarinen, mit welchen sie ihren Gewinn theilten. Die Fremden
durften die Stadt nicht betreten und wurden in den Factoreien
streng bewacht. Den Chinesen gegenüber waren sie formell und
factisch rechtlos und hatten kein Mittel in Händen, der willkürlichen
Bedrückung zu begegnen. Die Mandarinen erpressten das
Aeusserste und schraubten ihre Ansprüche immer höher. Das
veranlasste periodische Conflicte, die häufig zu Suspendirung des
7) H on bedeutet Firma.