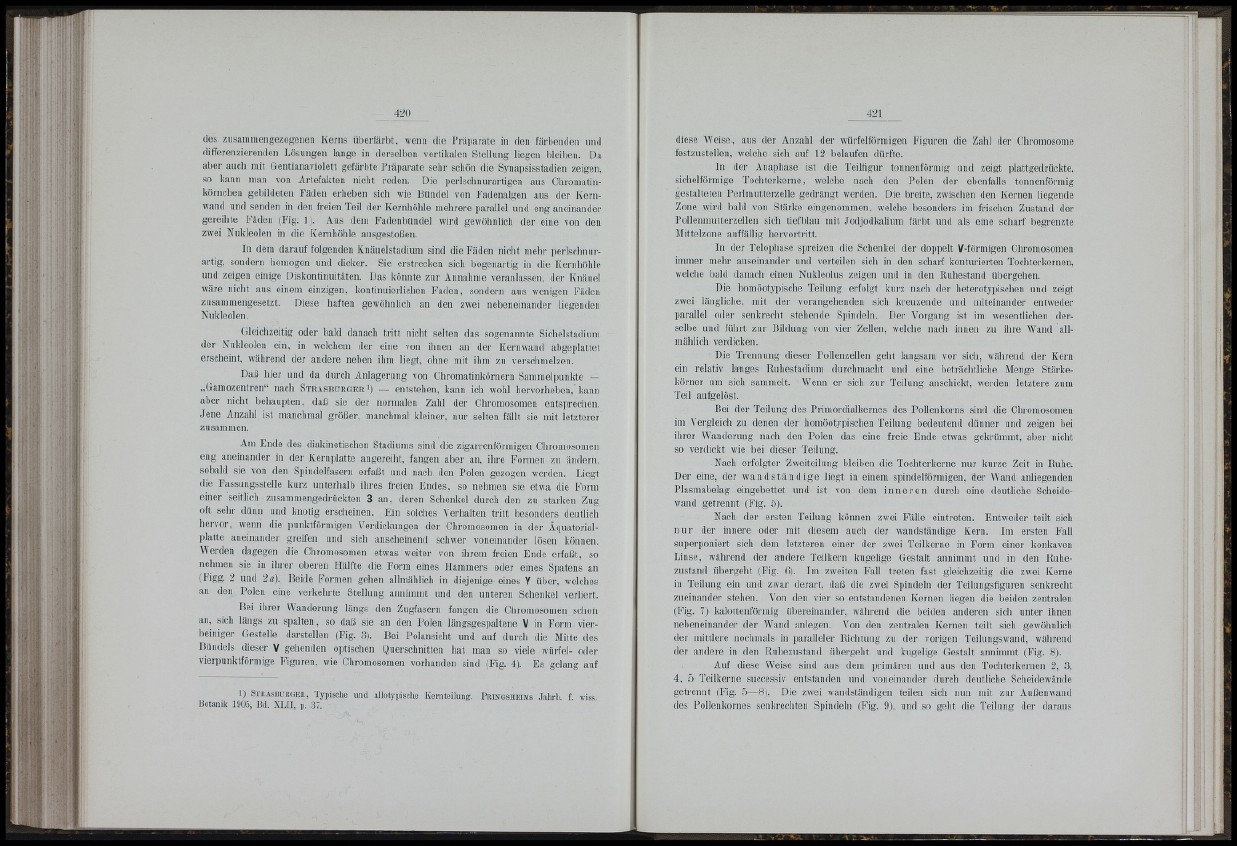
des ziisamnieiigezogenen Kerns überfärbt, wenn die Präpai-ate in den färbenden und
differenzierenden Lösungen lange in derselben vertikalen Stellung liegen bleiben. Da
aber aucli mit Gentianaviolett gefärbte Präparate sebr schön die Synapsisstadien zeigen,
so kann man von Artefakten niclit reden. Die perlscliniirartigen aus Cliroraatin-
körnchen gebildeten Fäden erlieben sich wie Bündel von Fadenalgen aus der Kernwand
und senden in den freien Teil der Kernliöhle melirere parallel und eng aneinander
gereihte Fäden (Fig. ]). Aus dem Fadenbündel wird gewöhnlich der eine von den
zwei Nukleolen in die Kernliöhle ausgestoßen.
In dem darauf folgenden Knäuelstadium sind die Fäden nicht melir perlschniir-
artig, sondern liomogen und dicker. Sie erstrecken sich bogenartig in die Kernliölile
und zeigen einige Diskontinuitäten. Das könnte zur Annahme veranlassen, der Knäuel
wäre niclit aus einem einzigen, kontinuierliclien Faden, sondern ans wenigen Fäden
zusammengesetzt. Diese haften gewöhnlich an den zwei nebeneinander liegenden
Nukleolen.
Gleichzeitig oder bald danach tritt nicht selten das sogenannte Sichelstadium
der iSnkleolen ein, in welchem der eine von ihnen an der Kern wand abgeplattet
erscheint, wälirend der andere neben ilim liegt, ohne mit ilim zu versclimelzen.
Daß liier und da durch Anlagerung von Cliromatinkörnern Sammelpunkte —
„Gamozentren“ nacli S t r a s b u r g e r ') — entstellen, kann ich wohl hervorheben,'kann
aber niclit behaupten, daß sie der normalen Zalil der Chromosomen entsprechen.
Jene Anzalil ist manclimal größer, manchmal kleiner, nur selten fällt sie mit letzterer
zusammen.
Am Ende des diakinetischen Stadiums sind die zigarrenförmigen Chromosomen
eng aneinander in der Kernjilatte angereilit, fangen aber an, iiire Formen zu ändern,
sobald sie von den Spindelfasern erfaßt und nacli den Polen gezogen werden. Liegt
die Fassungsstelle kurz nnterlialb ilires freien Endes, so nehmen sie etwa die Form
einer seitlicli ziisammengedrückten 3 an, deren Sclienkel durch den zu starken Zug
oft selir dünn und knotig erscheinen. Ein solches Verhalten tritt besonders deutlich
hervor, wenn die punktförmigen Verdickungen der Chromosomen in der Äquatorialplatte
aneinander greifen und sich anscheinend schwer voneinander lösen können.
Werden dagegen die Chromosomen etwas weiter von ihrem freien Ende erfaßt, so
nehmen sie in ihrer oberen Hälfte die Form eines Hammers oder eines Spatens an
(Figg. 2 und 2ä). Beide Formen gehen allmälilich in diejenige eines Y über, welches
an den Polen eine verkehrte Stellung annimmt und den unteren Schenkel verliert.
Bei ilirer Wanderung längs den Zugfasern fangen die Chromosomen schon
an, sich längs zu spalten, so daß sie an den Polen längsgespaltene V in Form vierbeiniger
Gestelle darstellen (Fig. 3). Bei Poiansicht und auf durcli die Mitte des
Bündels dieser V gellenden optischen Querschnitten hat man so viele Würfel- oder
vierpunktförmige Figuren, wie Chromosomen vorhanden sind (Fig. 4). Es gelang auf
1) S t r a s b u r g e r , Typische und allotypisclie Kernteilung. P r in g s h e im s Jalirb. f. wiss.
Botanik 1905, Bd. XLII, p. 37.
diese Weise., ans der Anzahl der würfelförmigen Figuren die Zahl der Chromosome
festzustellen, welclie sicli auf 12 belaufen dürfte.
In der Aiiaphase ist die Teiliigur tonnenförmig und zeigt plattgedrückte,
sichelförmige Tocliterkerne, welclie nacli den Polen der ebenfalls tonnenförmig
gestalteten Perlmutterzelle gedrängt werden. Die breite, zwisclien den Kernen liegende
Zone wird bald von Stärke eingenommen, welche besonders im frisclien Zustand der
Pollenmutterzellen sicli tiefblau mit Jodjodkalium färbt und als eine scliarf begrenzte
Mittelzone auffällig liervortritt.
In der Teloiiliase spreizen die Schenkel der doppelt V-förmigen Chromosomen
immer mehr auseinander und verteilen sich in den scharf konturierten Tocliterkernen,
welclie bald danach einen Nukleolus zeigen und in den Ruliestand übergehen.
Die homöotypische Teilung erfolgt kurz nach der heterotyiiischen und zeigt
zwei längliche, mit der vorangelienden sicli kreuzende und miteinander entweder
parallel oder senkrecht stellende Spindeln. Der Vorgang ist im wesentlichen derselbe
und fülirt zur Bildung von vier Zellen, welche nacii innen zu ilire Wand allmählich
verdicken.
Die Trennung dieser Pollenzellen geht langsam vor sich, während der Kern
ein relativ langes Ruhestadium durchmacht und eine beträchtliciie Menge Stärkekörner
um sich sammelt. Wenn er sich zur Teilung anschickt, werden letztere zum
Teil aufgelöst.
Bei der Teilung des Primordialkernes des Pollenkorns sind die Chromosomen
im Vergleich zu denen der liomöotypischen Teilung bedeutend dünner und zeigen bei
ilirer Wanderung nach den Polen das eine freie Ende etwas gekrümmt, aber niclit
so verdickt wie bei dieser Teilung.
Nach erfolgter Zweiteilung bleiben die Tochterkerne nur kurze Zeit in Ruhe.
Der eine, der w a n d s t ä n d i g e liegt in einem spindelförmigen, der Wand anliegenden
Plasmabelag eingebettet nnd ist von dem i n n e r e n durcli eine deutliche Scheidewand
getrennt (Fig. 5).
Nach der ersten Teilung können zwei Fälle eintreten. Entweder teilt sich
n u r der innere oder mit diesem auch der wandständige Kern. Im ersten Fall
snperponiert sich dem letzteren einer der zwei Teiikerne in Form einer konkaven
Linse, während der andere Teilkern kugelige Gestalt annimmt und in den Rulie-
znstand übergeht (Fig. G). Im zweiten Fall treten fast gleiclizeitig die zwei Kerne
in Teilung ein und zwar derart, daß die zwei Spindeln der Teilungsfiguren senkreclit
zueinander stellen. Von den vier so entstandenen Kernen liegen die beiden zentralen
(Fig. 7) kalottenförmig übereinander, während die beiden anderen sicli unter ihnen
nelieneiiiander der Wand anlegen. Von den zentralen Kernen teilt sich gewöhnlich
der mittlere nochmals in paralleler Richtung zu der vorigen Teilungswand, während
der andere in den Riiliezustand übergelit und kugelige Gestalt annimmt (Fig. 8).
Auf diese Weise sind aus dem primären und aus den Tocliterkernen 2, 3,
4, 5 Teilkerne successiv entstanden und voneinander durch deutliche Scheidewände
getrennt (Fig. 5—8). Die zwei wandständigen teilen sich nun mit zur Außenwand
des Polleiikoriies senkrecliteii Spindeln (Fig. 9), und so gelit die Teilung der daraus