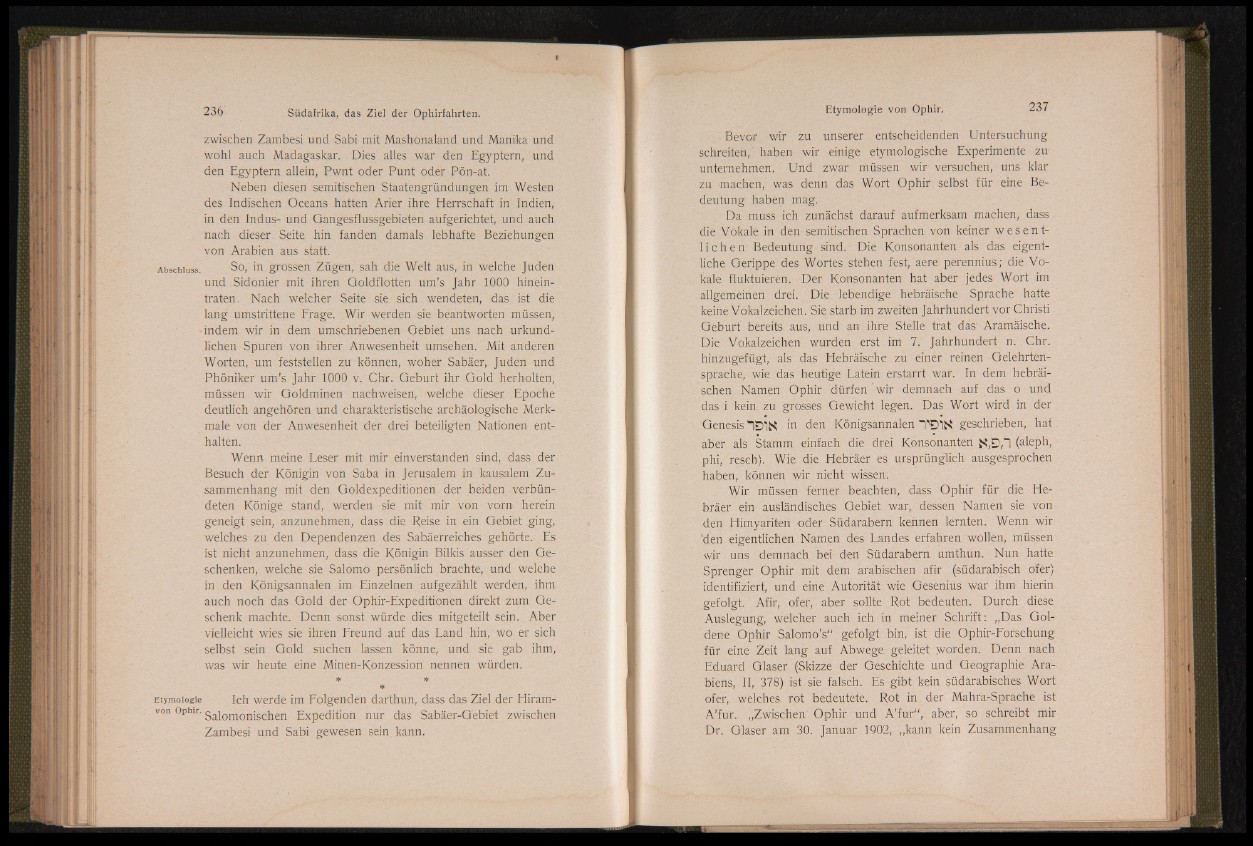
Abschluss.
Etymologie
von Ophir.
zwischen Zambesi und Sabi mit Mashonaland u n d Manika und
wohl auch Madagaskar. Dies alles war den Egyptern, und
den Egyptern allein, Pw n t oder P u n t oder Pön-at.
Neben diesen semitischen Staa tengründungen im Westen
des Indischen Oceans hatten Arier ihre Herrschaft in Indien,
in den Indus- u n d Gangesflussgebieten aufgerichtet, und auch
nach dieser Seite hin fanden damals lebhafte Beziehungen
von Arabien aus sfatt.
So, in grossen Zügen, sah die Welt aus, in welche Juden
und Sidonier mit ihren Goldflotten um 's Jah r 1000 hineintraten.
Nach welcher Seite sie sich wendeten, das ist die
lang umstrittene Frage. Wir werden sie beantworten müssen,
indem wir in dem umschriebenen Gebiet uns nach u rk u n d lichen
Spuren von ih rer Anwesenheit umsehen. Mit anderen
Worten, um feststellen zu können, woher Sabäer, Juden und
P höniker um's Jah r 1000 v. Ch r. G eb u rt ihr Gold herholten,
müssen wir Göldminen nachweisen, welche dieser Epoche
deutlich angehören u n d charakteristische archäologische Merkmale
von d er Anwesenheit der drei beteiligten Nationen enthalten.
Wenn meine Leser mit mir einverstanden sind, dass der
Besuch d er Königin von Saba in Jerusalem in kausalem Zusammen
h an g mit den Goldexpeditionen der beiden v e rb ü n deten
Könige stand, werden sie mit mir von vorn herein
geneigt sein, anzunehmen, dass die Reise in ein Gebiet ging,
welches zu den Dependenzen des Sabäerreiches gehörte. Es
ist n ich t anzunehmen, dass die Königin Bilkis ausser den Geschenken,
welche sie Salomo persönlich brachte, u n d welche
in den Königsannalen im Einzelnen aufgezählt werden, ihm
auch noch das Gold der Ophir-Expeditionen direkt zum Geschenk
machte. Denn sonst w ü rd e dies mitgeteilt sein. Aber
vielleicht wies sie ihren Freund au f das Land hin, wo er sich
selbst sein G o ld suchen lassen könne, u n d sie gab ihm,
was wir heute eine Minen-Konzession nennen würden.
* *
*
Ich werde im Folgenden darthun, dass das Ziel der Hiram-
Salomonischen Expedition n u r das Sabäer-Gebiet zwischen
Zambesi u n d Sabi gewesen sein kann.
Bevor wir zu unserer , entscheidenden U n tersu ch u n g
schreiten,' haben wir einige etymologische Experimente zu
unternehmen. U n d zwar müssen wir versuchen, uns klar
zu machen,’ was denn das Wort O p h ir selbst fü r eine Bed
eu tu n g haben mag.
Da muss ich zunächst darauf aufmerksam machen, dass
die Vokale in den semitischen Sprachen von keiner w e s e n t l
i c h e n Bedeutung sind. Die Konsonanten ■ als das eigentliche
Gerippe des Wortes stehen fest, aere peren n iu s; die Vokale
fluktuieren. Der Konsonanten hat aber jedes W ort im
allgemeinen drei. Die lebendige hebräische Sprache hatte
keine V okalzeichen. Sie starb im zweiten J a h rh u n d e rt vor Christi
G eb u rt bereits aus, u n d an ihre Stelle tra t das' Aramäische.
Die Vokalzeichen wurden erst im 7. J a h rh u n d e rt n. Chr.
hinzugefügt, als das Hebräische zu einer reinen Gelehrtensprache,
wie das heutige Latein ersta rrt war. In dem hebräischen
Namen O p h ir dürfen wir demnach auf das o u n d
das i kein zu grosses Gewicht legen. Das W ort wird in der
Genesis “ID1K in den Königsannalen T D lN geschrieben, hat
aber als Stamm einfach die drei Konsonanten N,D,"1 (aleph,
phi, resch). Wie die Hebräe r es ursprünglich ausgesprochen
haben, können wir nicht wissen.
Wir müssen ferner beachten, dass O p h ir fü r d ie : Heb
räe r ein ausländisches Gebiet war, dessen Namen sie von
den Himyariten oder S üdarabern kennen lernten. Wenn wir
‘den eigentlichen Namen des Landes erfahren wollen, müssen
wir uns demnach bei den S üdarabern umthun. N u n hatte
Sprenger O p h ir mit dem arabischen afir (südarabisch ofer)
identifiziert, und eine Autorität wie Gesenius war ihm hierin
gefolgt. Afir, ofer, aber sollte Rot bedeuten. D u rch diese
Auslegung, welcher auch ich in meiner Schrift: „Das Goldene
O p h ir Salomo’s " gefolgt bin, ist die O p h ir-F o rs ch u n g
fü r eine Zeit lang auf Abwege geleitet worden. Denn nach
E duard Glaser (Skizze d er Geschichte u n d G eographie Arabiens,
II, 378) ist sie falsch. Es gibt kein südärabisches W ort
ofer, welches ro t bedeutete. Rot in d er Mahra-Sprache ist
A'fur. „Zwischen O p h ir u n d A’fur", aber, so schre ibt mir
Dr. Glaser am 30. Jan u ar 1902, „kann kein Z usam menhang