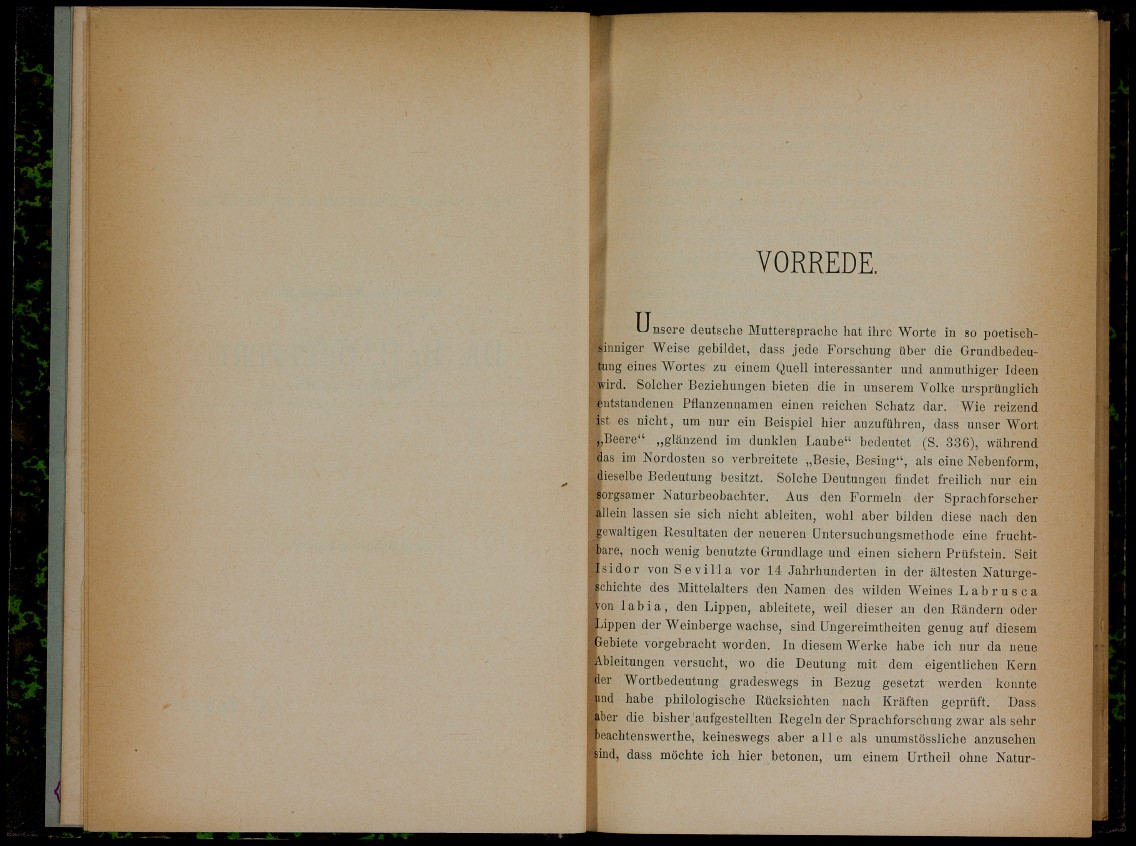
VORREDE.
U nsere deutsche Muttersprache hat ihre Worte in so poetischsinniger
Weise gebildet, dass jede Forschung über die Grundbedeutung
eines Wortes zu einem Quell interessanter und anmuthiger Ideen
wird. Solcher Beziehungen bieten die in unserem Volke ursprünglich
entstandenen Pflanzennamen einen reichen Schatz dar. Wie reizend
ist es nicht, um nur ein Beispiel hier anzuführen, dass unser Wort
„Beere" „glänzend im dunklen Laube" bedeutet (S. 336), während
das im Nordosten so verbreitete „Besie, Besing", als eine Nebenform,
dieselbe Bedeutung besitzt. Solche Deutungen findet freilich nur ein
sorgsamer Naturbeobachter. Aus den Formeln der Sprachforscher
allein lassen sie sich nicht ableiten, wohl aber bilden diese nach den
gewaltigen Resultaten der neueren üntersuchungsmethode eine fruchtbare,
noch wenig benutzte Grundlage und einen sichern Prüfstein. Seit
I s i d o r von S e v i l l a vor 14 Jahrhunderten in der ältesten Naturgeschichte
des Mittelalters den Namen des wilden Weines L abrus c a
¡von l abi a , den Lippen, ableitete, weil dieser an den Rändern oder
Lippen der Weinberge wachse, sind Ungereimtheiten genug auf diesem
Gebiete vorgebracht worden. In diesem Werke habe ich nur da neue
; Ableitungen versucht, wo die Deutung mit dem eigentlichen Kern
der Wortbedeutung gradeswegs in Bezug gesetzt werden konnte
: und habe philologische Rücksichten nach Kräften geprüft. Dass
: aber die bisher'aufgestellten Regeln der Sprachforschung zwar als sehr
1 beachtenswerthe, keineswegs aber a l l e als unumstössliche anzusehen
i sind, dass möchte ich hier betonen, um einem ürtheil ohne Natur