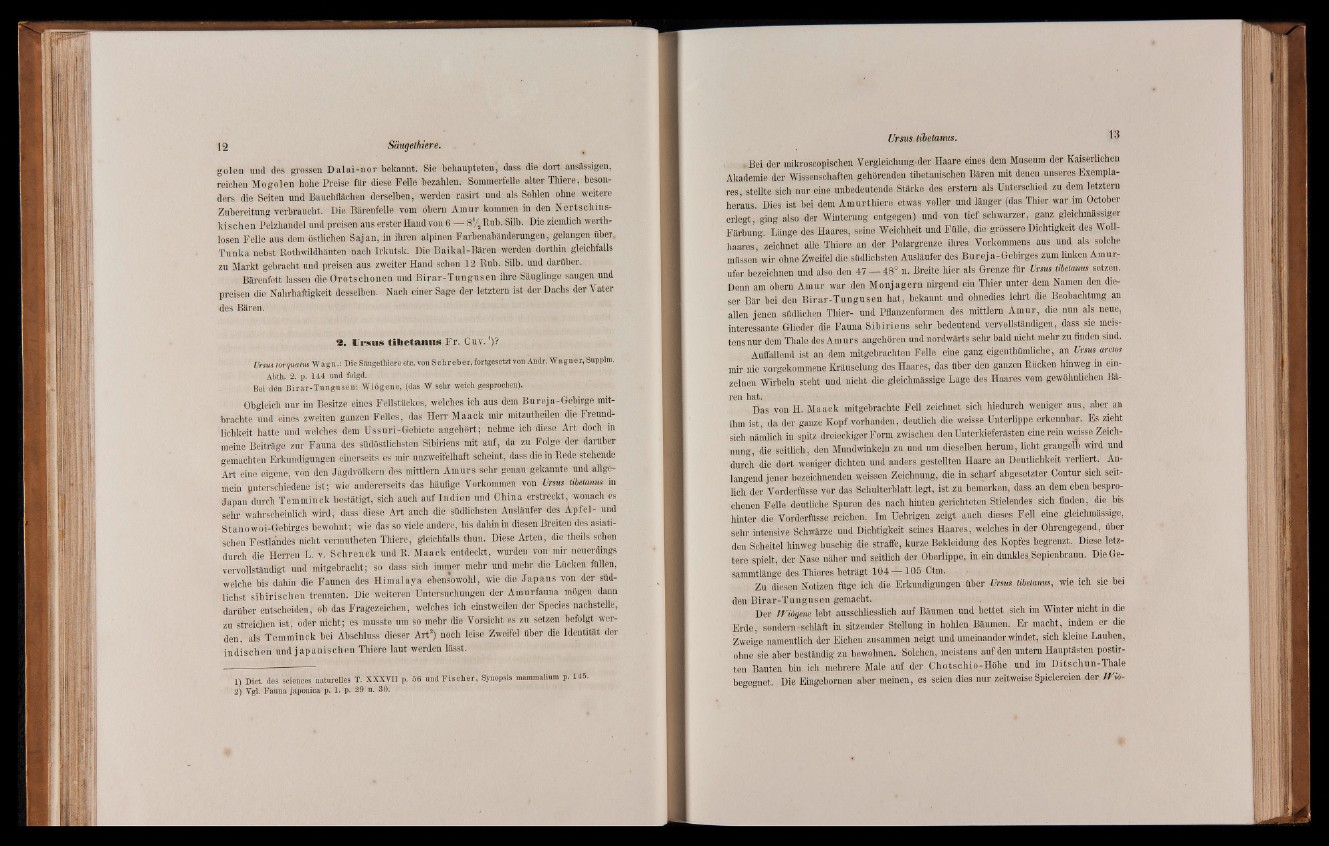
golen und des grossen D alai-n o r bekannt. Sie behaupteten, dass die dort ansässigen,
reichen Mogolen hohe Preise für diese Felle bezahlen. Sommerfelle alter Thiere, besonders
die Seiten und Bauchflächen derselben, werden rasirt und als Sohlen ohne weitere
Zubereitung verbraucht. Die Bärenfelle vom öbern Amur kommen in den Nertsc-hins-
kischen Pelzhandel und preisen aus erster Hand von 6 — 8’/2Rub. Silb. Die ziemlich werthlosen
Felle aus dem östlichen Sajan, in ihren alpinen Farbenabänderungen, gelangen über.
Tunka nebst Rothwildhäuten nach Irkutsk. Die Baikal-Bären werden dorthin gleichfalls
zu Markt gebracht und preisen aus zweiter Hand schon 12 Rub. Silb. und darüber.
Bärenfett lassen die O rotschonen und B irar-T ungu sen ihre Säuglinge saugen und
preisen die Nahrhaftigkeit desselben. Nach einer Sage der letztem ist der Dachs der Vater
des Bären.
9 . U rsu s tib e ta iiu s F r. C uv.')?
Ursustorquatm'Wagn.: Die Sängethiere etc. vonSchreber, fortgesetzt von Andr. W agner, Supplm.
Abth. 2. p. 14+ Und folgd.
Bei (Un B irar-T u ngu sen: W iögene, (das W sehr weich gesprochen).
Obgleich nur im Besitze eines Fellstückes, welches ich aus dem BurejacGebirge mitbrachte
und eines zweiten ganzen Felles, das Herr Maack mir mitzutheilen die Freund-
•¿chkeit hatte und welches dem Ussuri-Gebiete angehört; nehme ich diese: Art doch in
meine Beiträge zur Fauna des südöstlichsten Sibiriens mit auf, da zu Folge der darüber
gemachten Erkundigungen einerseits es mir unzweifelhaft scheint, dass die in Rede stehende
Art eine eigene, von den Jagdvölkem des mittlem Amurs sehr genau gekannte und allgemein
unterschiedene ist; wie andererseits das häufige Vorkommen von Ursus tibetanus in
Japan durch Temminck bestätigt, sich auch auf Indien und China erstreckt, wonach es
sehr wahrscheinlich wird, dass diese Art auch die: südlichsten Ausläufer des Apfel- und
Stanowoi-Gebirges bewohnt; wie das so viele andere, bis dahin in diesen Breiten des asiatischen
Festlandes nicht vermutheten Thiere, gleichfalls thun. Diese Arten; die theils schon
durch die Herren L. v. Schrenck und R. Maack entdeckt, wurden von mir neuerdings
vervollständigt und mitgebracht; so dass sich immer mehr und mehr die Lücken füllen,
welche bis dahin die Faunen des H im aläyä ebensowohl, wie die Jap an s von der südlichst
sibirischen trennten. Die weiteren Untersuchungen der Amurfauna mögen dann
darüber entscheiden, ob das Fragezeichen, welches ich einstweilen der Species nachstelle,
zu streichen ist, oder nicht; es musste um so mehr die Vorsicht es zu setzen befolgt werden,
a ls Temminck bei Absöhluss dieser Art2) noch leise Zweifel über die Identität der
indischen und jap an isch en Thiere laut werden lässt.
1) D iet'äes Sciences naturelles T. XXXVII p. 56 und F isc h er, Synopsis mammalium p. 145.
2) Vgl. Fauna japonica p. 1'. p. 29 u. 301
.Bei der mikroscopisehen Vergleichung-der Haare eines dem Museum der Kaiserlichen
Akademie der Wissenschaften gehörenden tibetanischen Bären mit denen unseres Exempla-
res, stelltesich nur eine unbedeutende Stärke des erstem als Unterschied zu dem letztem
heraus. Dies ist bei dem Amurthiere etwas voller und länger (das Thier war im October
erlegt,bging also der Winterung entgegen) und von tief schwarzer, ganz gleichmässiger
Färbung. Länge des Haares, seine Weichheit und Fülle, die grössere Dichtigkeit des.Woll-
haares, zeichnet alle Thiere an der Polargrenze ihres Vorkommens aus und als solche
müssen wir ohne Zweifel die südlichsten Ausläufer.des Burej a-Gebirges zum linken Amurufer
bezeichnen und also den 47 — 48° n. Breite hier als Grenze für Ursus tibetanus setzen.
Denn am obem Amur war den M onjagern nirgend ein Thier unter dem Namen den dieser
Bär bei den B irar-T ungu sen hat, bekannt und ohnedies lehrt die Beobachtung an
allen jenen südlichen Thier- und Pflanzenformen des mittlem Am ur, die nun als neue,
interessante Glieder'die Fauna Sibiriens sehr bedeutend vervollständigen, dass sie meistens
nur dem Thale des Amurs angehören und nordwärts sehr bald nicht mehr zu finden sind.
Auffallend ist an dem mitgebrachten Felle eine gan$ eigentümliche; an Ursus antos
mir nie vorgekommene Kräuselung des Haares, das über den ganzen Rücken hinweg in einzelnen
Wirbeln steht und nicht die gleichmässige Lage des Haares vom gewöhnlichen Bären
hat. • ", '
Das von H. Maack mitgebrachte Fell zeichnet sich hiedurch weniger aus, aber an
ihm ist, da der .ganze Kopf vorhanden, deutlich die weisse Unterlippe erkennbar. Es zieht
sich nämlich in spitz dreieckiger Form zwischen den Unterkieferästen einerein weisse Zeichnung,
die seitlich,:.den Mundwinkeln zu und um dieselben herum, licht graugelb wird und
durch die dort weniger dichten und anders gestellten Haare an Deutlichkeit verliert. Anlangend
jener bezeichnenden weissen Zeichnung, die in scharf abgesetzter Contur sich seitlich
der Vorderfüsse vor das Schulterblatt legt, ist zu bemerken, dass an dem eben besprochenen
Felle deutliche Spuren des nach hinten gerichteten Stielendes sich finden,: die bis
hinter die Vorderfüsse .reichen. Im üebrigen zeigt auch dieses Fell eine gleichmässige,
sehr intensive Schwärze und Dichtigkeit seines Haares, welches in der Ohrengegend, über
den Scheitel hinweg buschig die straffe, kurze Bekleidung des Kopfes begrenzt. Diese letztere
spielt, der Nase näher und seitlich der Oberlippe, in ein dunkles, Sepienbraun. Die Ge-
sammtlänge des Thieres beträgt 104 — 105 Ctm.
Zu diesen Notizen füge ich die Erkundigungen über Ursus tibetanus, wie ich sie bei
den B irar-T ungusen gemacht.
Der rridgem lebt ausschliesslich auf Bäumen und bettet sich im Winter nicht in die
Erde, sondern'schläft in sitzender Stellung in hohlen Bäumen. E r macht, indem er die
Zweige nam entlich der Eichen zusammen neigt und umeinander windet, sich kleine Lauben,
ohne sie aber beständig zu bewohnen. Solchen, meistens auf den untern Hauptästen postir-
ten Bauten bin ich mehrere Male auf der Chotschio-Höhe und im Ditschun-Thale
begegnet. Die Eingebornen aber meinen, es seien dies nur zeitweise Spielereien der Wit>-