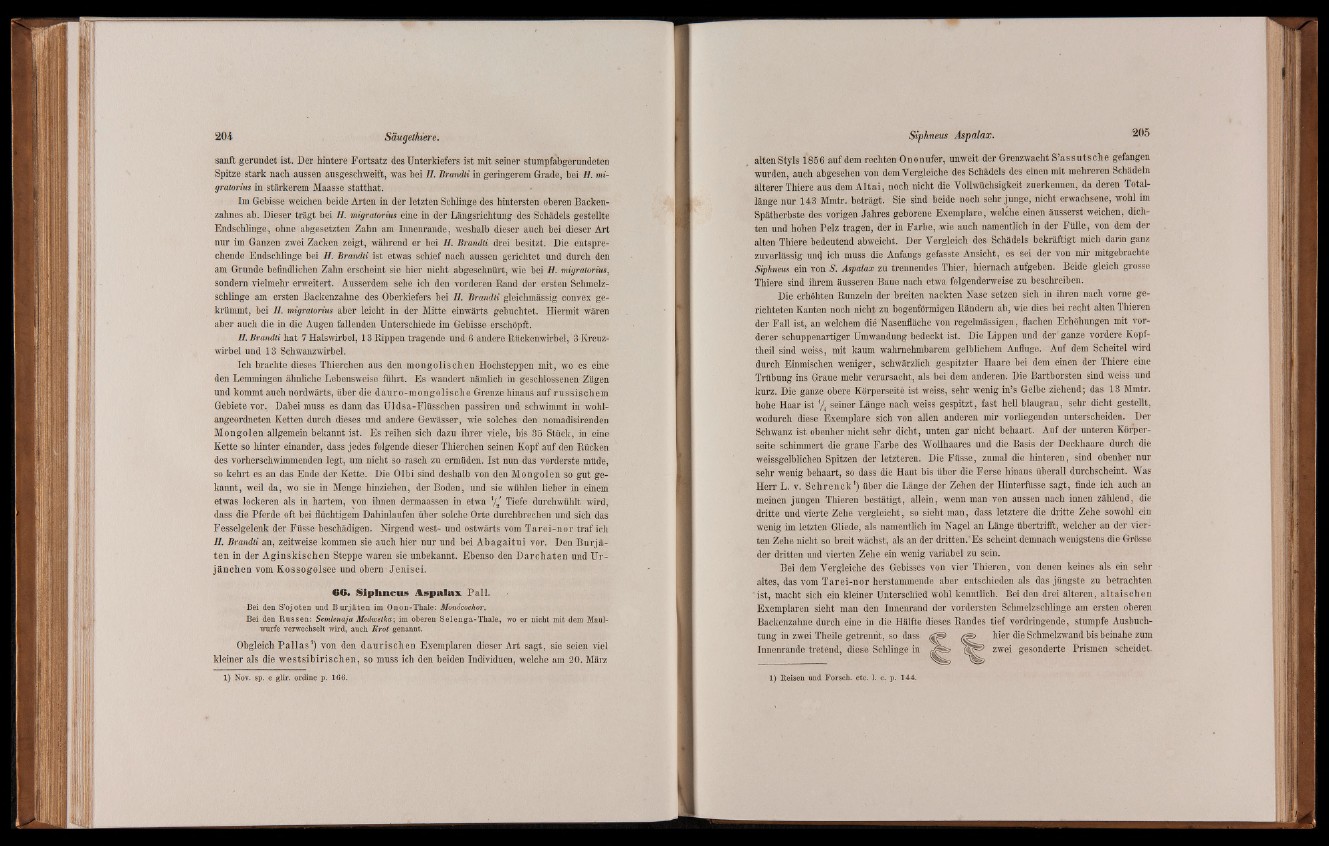
sanft gerundet ist. Der hintere Fortsatz des Unterkiefers ist mit seiner stumpfabgerundeten
Spitze stark nach aussen ausgeschweift, was bei B. Brandti in geringerem Grade, hei H. migratorius
in stärkerem Maasse statthat.
Im Gebisse weichen beide Arten in der letzten Schlinge des hintersten oberen Backenzahnes
ab. Dieser trägt bei H. migratorius eine in der Längsrichtung des Schädels gestellte
Endschlinge., ohne abgesetzten Zahn am Innenrande, weshalb dieser auch bei dieser Art
nur im Ganzen zwei Zacken zeigt, während er bei H. Brandti drei besitzt. Die entsprechende
Endschlinge bei H. Brandti ist etwas schief nach aussen gerichtet und durch den
am Grunde befindlichen Zahn erscheint sie hier nicht abgeschnürt, wie bei H. migratorius,
sondern vielmehr erweitert. Ausserdem sehe ich den vorderen Rand der ersten Schmelz-
schlinge am ersten Backenzahne des Oberkiefers bei B. Brandti gleichmässig convex gekrümmt,
bei B. migratorius aber leicht in der Mitte einwärts gebuchtet. Hiermit wären
aber auch die in die Augen fallenden Unterschiede im Gebisse erschöpft.
B. Brandti hat 7 Halswirbel, 13 Hippen tragende und 6 andere Bückenwirbel, 3 Kreuzwirbel
und 13 Schwanzwirbel.
Ich brachte dieses Thierchen aus den m ongolischen Hochsteppen mit, wo es eine
den Lemmingen ähnliche Lebensweise führt. Es wandert nämlich in geschlossenen Zügen
und kommt auch nordwärts, über die dauro-m ongolische Grenze hinaus auf russischem
Gebiete vor. Dabei muss es dann das Uldsa-Flüsschen passiren und schwimmt in wohlangeordneten
Ketten durch dieses und andere Gewässer, wie solches den nomadisirenden
Mongolen allgemein bekannt ist. Es reihen sich dazu ihrer viele, bis 35 Stück, in eine
Kette so hinter einander, dass jedes folgende dieser Thierchen seinen Kopf auf den Rücken
des vorherschwimmenden legt, um nicht so rasch zu ermüden. Ist nun das vorderste müde,
so kehrt es an das Ende der Kette. Die Olbi sind deshalb von den Mongolen so gut gekannt,
weil da, wo sie in Menge hinziehen, der Boden, und sie wühlen lieber in einem
etwas lockeren als in hartem, von ihnen dermaassen in etwa ■’/ ' Tiefe durchwühlt wird,
dass die Pferde oft bei flüchtigem Dahinlaufen über solche Orte durchbrechen und sich das
Fesselgelenk der Füsse-beschädigen. Nirgend west- und ostwärts vom T arei-n or traf ich
B. Brandti an, zeitweise kommen sie auch hier nur und bei A bagaitui vor. Den B urjäten
in der A ginskischen Steppe waren sie unbekannt. Ebenso den D archaten und Ur-
jänchen vom Kossogolsee und obem Jeuisei.
66. Siplineus isjialav Pall.
Bei den S’ojoten und B u rjäten im Onon-Thale: Monöcochor.
Bei den B ussen: Semlenaja Medwetka; im oberen Selenga-Thale, wo er nicht mit dem Maulwurfe
verwechselt wird, auch Krot genannt.
Obgleich Pallas*) von den daurisch en Exemplaren dieser Art sagt, sie seien viel
kleiner als die w estsibirischen, so muss ich den beiden Individuen, welche am 20. März
1) Nov. sp. e glir. ordine p. 166.
altenStyls 1856 auf dem rechten Ononufer, unweit der Grenzwacht S’assu tsche gefangen
wurden, auch abgesehen von dem Vergleiche des Schädels des einen mit mehreren Schädeln
älterer Thiere aus dem A ltai, noch nicht die Vollwüchsigkeit zuerkennen, da deren Totallänge
nur 143 Mmtr. beträgt. Sie sind beide noch sehr junge, nicht erwachsene, wohl im
Spätherbste des vorigen Jahres geborene Exemplare, welche einen äusserst weichen, dichten
und hohen Pelz tragen, der in Farbe,-wie auch namentlich in der Fülle, von dem der
alten Thiere bedeutend abweicht. Der Vergleich des Schädels bekräftigt mich darin ganz
zuverlässig und ich muss die Anfangs gefasste Ansicht, es sei der von mir mitgebrachte
Siphneus ein von S. Aspalax zu trennendes Thier, hiernach aufgeben. Beide gleich grosse
Thiere sind ihrem äusseren Baue nach etwa folgenderweise zu beschreiben.
Die erhöhten Runzeln der breiten nackten Nase setzen sich in ihren nach vorne gerichteten
Kanten noch nichf zu bogenförmigen Rändern ab, wie dies bei reqht alten Thieren
der Fall ist, an welchem die Nasenfläche von regelmässigen, flachen Erhöhungen mit vorderer
schuppenartiger Umwandung bedeckt ist. Die Lippen und der1 ganze vordere Kopf-
theil sind weiss, mit kaum wahrnehmbarem gelblichem Anfluge. Auf dem Scheitel wird
durch Einmischen weniger, schwärzlich gespitzter Haare bei dem einen der Thiere eine
Trübung ins Graue mehr verursacht, als bei dem anderen. Die Bartborsten sind weiss und
kurz. Die ganze obere Körperseite ist weiss, sehr wenig in’s Gelbe ziehend; das 13 Mmtr.
hohe Haar ist */, seiner Länge nach weiss gespitzt, fast hell blaugrau, sehr dicht gestellt,
wodurch diese Exemplare sich von allen anderen mir vorliegenden unterscheiden. Der
Schwanz ist obenher nicht sehr dicht, unten gar nicht behaart. Auf der unteren Köiper-
seite schimmert die graue Farbe des Wollhaares und die Basis der Deckhaare durch die
weissgelblichen Spitzen der letzteren. Die Füsse, zumal die hinteren, sind obenher nur
sehr wenig behaart, so dass die Haut bis über die Ferse hinaus überall durchscheint. "Was
Herr L. v. S ch ren ck ’) über die Länge der Zehen der Hinterfüsse sagt, finde ich auch an
meinen jungen Thieren bestätigt, allein, wenn man von aussen nach innen zählend, die
dritte und vierte Zehe vergleicht, so sieht man, dass letztere die dritte Zehe sowohl ein
wenig im letzten Gliede, als namentlich im Nagel an Länge übertrifft, welcher an der vierten
Zehe nicht so breit wächst, als an der dritten.'Es scheint demnach wenigstens die Grösse
der dritten und vierten Zehe ein wenig variabel zu sein.
Bei dem Vergleiche des Gebisses von vier Thieren, von denen keines als ein sehr
altes, das vom T arei-nor herstammende aber entschieden als das jüngste zu betrachten
‘ist, macht sich ein kleiner Unterschied wohl kenntlich. Bei den drei älteren, altaischen
Exemplaren sieht man den Innenrand der vordersten Schmelzschlinge am ersten oberen
Backenzahne durch eine in die Hälfte dieses Randes tief vordringende, stumpfe Ausbuchtung
in zwei Theile getrennt, so dass hier die Schmelzwand bis beinahe znm
Innenrande tretend, diese Schlinge in zwe* gesonderte Prismen scheidet.
I) Beisen und Forsch, etc. 1. c. p. 144.