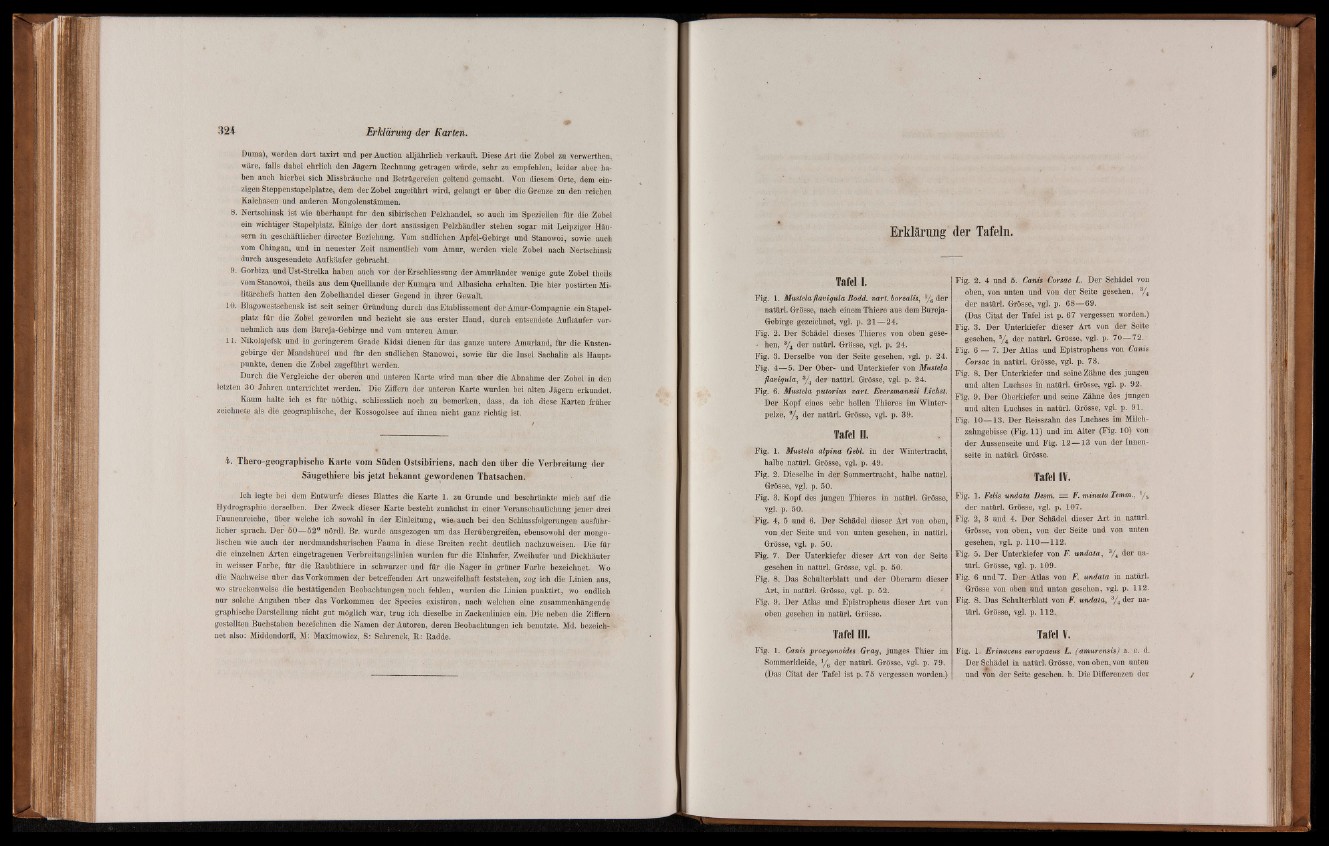
Duma), werden dort taxirt und per Auction alljährlich verkauft. Diese Art die Zobel zu verwerthen,
wäre, falls dabei ehrlich den Jägern Rechnung getragen würde, sehr zu empfehlen, leider aber haben
auch hierbei sich Missbräuche und Betrügereien geltend gemacht. Von diesem Orte, dem einzigen
Steppenstapelplatze, dem der Zobel zugeführt wird, gelangt er über die Grenze zu den reichen
Kalchasen und anderen Mongolenstämmen.
8. Nertschinsk ist wie überhaupt für den sibirischen Pelzhandel, so auch im Speziellen für die Zobel
ein wichtiger Stapelplatz. Einige der dort ansässigen Pelzhändler stehen sogar mit Leipziger Häusern
in geschäftlicher directer Beziehung. Vom südlichen Apfel-Gebirge und Stanowoi, sowie auch
vom Chingan, und in neuester Zeit namentlich vom Amur, werden viele Zobel nach Nertschinsk
durch ausgesendete Aufkäufer gebracht.
9. Gorbiza und Ust-Strelka haben auch vor der Erschliessung der Amurländer wenige gute Zobel theils
vom Stanowoi, theils aus dem Quelllande der Kum^ra und Albasicha erhalten. Die hier postirten Militärchefs
hatten den Zobelhandel dieser Gegend in ihrer Gewalt.
10. Blagowestschensk ist seit seiner Gründung durch das Etablissement der Amur-Compagnie ein Stapelplatz
für die Zobel geworden und bezieht sie aus erster Hand, durch entsendete Aufkäufer vornehmlich
aus dem Bureja-Gebirge und vom unteren Amur.
11. Nikolajefsk und in geringerem Grade Kidsi dienen für das ganze untere Amurland, für die Küstengebirge
der Mandshurei und für den südlichen Stanowoi, sowie für die Insel Sachalin als Hauptpunkte,
denen die Zobel zugeführt werden.
Durch die Vergleiche der oberen und unteren Karte wird man über die Abnahme der Zobel in den
letzten 30 Jahren unterrichtet werden. Die Ziffern der unteren Karte wurden bei alten Jägern erkundet.
Kaum halte ich es für nöthig, schliesslich noch zu bemerken, dass, da ich diese Karten früher
zeichnete als die geographische, der Kossogolsee auf ihnen nicht ganz richtig ist.
4. Thero-geographische Karte vom Süden Ostsibiriens, nach' den über die Verbreitung der
Säugethiere bis jetzt bekannt gewordenen Thatsachen.
Ich legte bei dem Entwürfe dieses Blattes die Karte 1. zu Grunde und beschränkte mich auf die
Hydrographie derselben. Der Zweck dieser Karte besteht zunächst in einer Veranschaulichung jener drei
Faunenreiche, über welche ich sowohl in der Einleitung, wie«auch bei den Schlussfolgerungen ausführlicher
sprach. Der 50—52° nördl. Br. wurde ausgezogen um das Hertibergreifen, ebensowohl der mongolischen
wie auch der nordmandshurischen Fauna in diese Breiten recht deutlich nachzuweisen. Die für
die einzelnen Arten eingetragenen Verbreitungslinien wurden für die Einhufer, Zweihufer und Dickhäuter
in weisser Farbe, für die Raubthiere in schwarzer und für die Nager in grüner Farbe bezeichnet. Wo
die Nachweise über das Vorkommen der betreffenden Art unzweifelhaft feststehen, zog ich die Linien aus,
wo streckenweise die bestätigenden Beobachtungen noch fehlen, wurden die Linien punktirt, wo endlich
nur solche Angaben über das Vorkommen der Species existiren, nach welchen eine zusammenhängende
graphische Darstellung nicht gut möglich war, trug ich dieselbe in Zackenlinien ein. Die neben die Ziffern
gestellten Buchstaben bezeichnen die Namen der Autoren, deren Beobachtungen ich benutzte. Md. bezeichnet
also: Middendorff, M: Maximowicz, S: Schrenck, R: Radde.
Erklärung der Tafeln.
Tafel I.
Fig. 1. Mustela flavigüla Bodd. m rt. borealis, pg der
natürl. Grösse, nach einem Thiere aus dem Bureja-
Gebirge gezeichnet, vgl. p..21—24.
Fig. 2. Der Schädel dieses Thieres von oben gese-
' hen, 3/ 4 der natürl. Grösse, vgl. p. 24.
Fig. 3. Derselbe von der Sdite gesehen, vgl. p. 24.
Fig. 4—5. Der Ober- und Unterkiefer von Mustela
flavigüla, 3/4 der natürl. Grösse, vgl. p. 24.
Fig. 6. Mustela putorius vart. Eversmannii Liehst.
Der Kopf eines sehr hellen Thieres im Winter-
pelzè, y 3 der natürl. Grösse, vgl. p. 39.
Tafel n.
Fig. 1. Mustela alpina Gébl. in der Wintertracht,
halbe natürl. Grösse, vgl. ,p. 49.
Fig. 2. Dieselbe in der Sommertracht, halbe natürl,
Grösse, vgl. p. 50.
Fig. 3. Kopf des jungen Thieres in natürl. Grösse,
vgl. p. 50.
Fig. 4, 5 und 6. Der Schädel dieser Art von oben,
von,der Seite und von unten gesehen, in natürl.
Grösse, vgl. p. 50.
Fig. 7. Der Unterkiefer dieser Art von der Seite
gesehen in natürl. Grösse, vgl. p. 50.
Fig. 8. Das Schulterblatt und der Oberarm dieser
Art, in natürl. Grösse, vgl. p. 52.
Fig. 9. Der Atlas und Epistropheus dieser Art von
oben gesehen in natürl. Grösse.
Tafel m.
Fig. 1. Canis procyonoides Gray, junges Thier im
Sommerkleide, */6 der natürl. Grösse, vgl. p. 79.
(Das Citat der Tafel ist p. 75 vergessen worden.)
Fig. 2. 4 und 5. Canis Corsac L. Der Schädel von
oben, von unten und von der Seite gesehen, %
der natürl. Grösse, vgl. p. 68—69.
P a s Citat der Tafel ist p. 67 vergessen worden.)
Fig. 3. Der Unterkiefer dieser Art von der Seite
gesehen, 3/ 4 der natürl. Grösse, vgl. p. 70—72.
Fig. 6 — 7, Der Atlas und Epistropheus von Canis
Corsac in natürl. Grösse, vgl. p. 73.
Fig. 8. Der Unterkiefer und seine Zähne des jungen
und alten Luchses in natürl. Grösse, vgl. p. 92.
Fig. 9. Der Oberkiefer, und seine Zähne des jungen
und alten Luchses in natürl. Grösse, vgl. p. 91.
Fig. 10—13. Der Reisszahn des Luchses im Milchzahngebisse
(Fig. 11) und im Alter (Fig. 10) von
der Aussenseite und Fig. 12—13 von der Innenseite
in natürl. Grösse^
Tafel IV.
Fig. 1. Felis undata Desm. = F. minuta Temm., l/ 5
der natürl. Grösse, vgl. p. 107.
Fig. 2, 3 und 4. Der. Schädel dieser Art in natürl.
Grösse, von oben, von der Seite und von unten
gesehen, vgl. p. 110—112.
Fig. ,5. Der Unterkiefer von F. undata, 3/ 4 der natürl.
Grösse, vgl. p. 109.
Fig. 6 und~7. Der Atlas von F. undata in natürl.
Grösse von oben und unten gesehen, vgl. p. 112.
Fig. 8. Das Schulterblatt von F. undata, 3/ 4 der natürl.
Grösse, vgl. p. 112.
Tafel V.
Fig. 1. Erinaceus europaeus L. (amurensis) a. c. d.
Der Schädel in natürl. Grösse, von oben, von unten
und von der Seite gesehen, b. Die Differenzen der