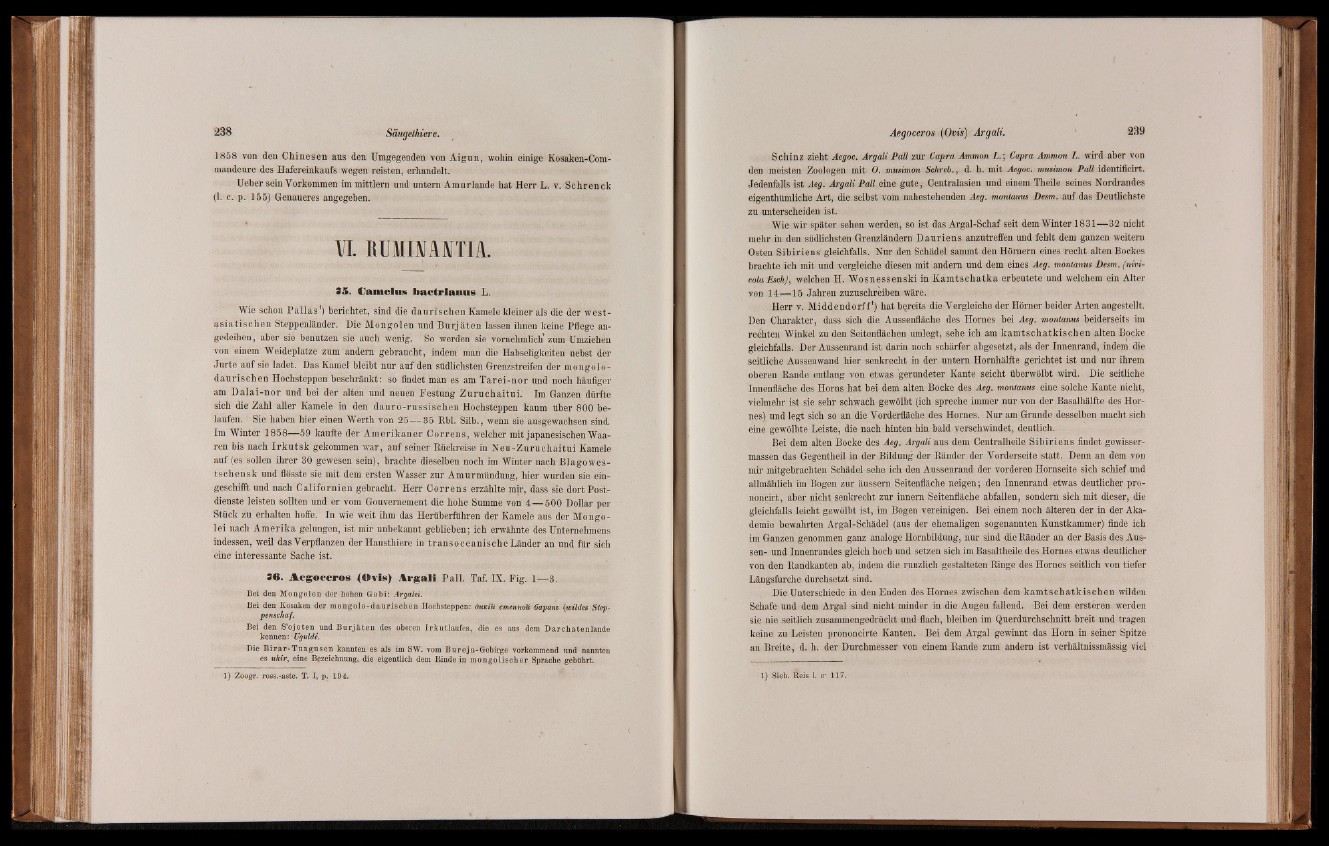
1858 von den C hinesen aus den Umgegenden von Aigun, wohin einige Kosaken-Com-
mandeure des Hafereinkaufs wegen reisten, erhandelt.
Ueber sein Vorkommen im mittlem und untem Amurlande hat Herr L. v. Schrenck
(1. e. p. 155) Genaueres angegeben.
VI. RUMINMTIA.
35. C u m c lu s Im c tr ia n u s L.
Wie schon P allas') berichtet, sind die daurischen Kamele kleiner als die der w estasiatisch
en Steppenländer. Die M ongolen und B urjäten lassen ihnen keine Pflege angedeihen,
aber sie benutzen sie auch wenig. So werden sie vornehmlich' zum Umziehen
von einem Weideplätze zum ändern gebraucht, indem man die Habseligkeiten' nebst der
Jurte auf sie ladet. Das Kamel bleibt nur auf den südlichsten Grenzstreifen der m ongolo-
daurischen Hochsteppen beschränkt: so findet man es am T arei-n ö r und noch häufiger
am D alai-n o r und bei der alten und neuen Festung Z uruchaitui. Im Ganzen dürfte
sich die Zahl aller Kamele in den daurö-russischen Hochsteppen kaum über 800 belaufen.
Sie haben hier einen Werth von 25— 35 Rbl. Silb., wenn sie ausgewachsen sind.
Im Winter 1858— 59 kaufte der A m erikaner C orrens, welcher mit japanesischen Waa-
ren bis nach Irk u tsk gekommen war, auf seiner Rückreise in N eu-Z uruchaitui Kamele
auf (es sollen ihrer 30 gewesen sein), brachte dieselben noch im Winter nach Blagowes-
tschensk und flösste sie mit dem ersten Wasser zur Amurmündung, hier wurden sie eingeschifft
und nach C alifornien gebracht. Herr C orrens erzählte mir, dass sie dort Postdienste
leisten sollten und er vom Gouvernement die hohe Summe von 4— 500 Dollar per
Stück zu erhalten hoffe. In wie weit ihm das Herüberführen der Kamele aus der Mongolei
nach Am erika gelungen, ist mir unbekannt geblieben; ich erwähnte des Unternehmens
indessen, weil das Verpflanzen der Hausthiere in transoceanische Länder an und für sich
eine interessante Sache ist.
3®. Aegoceros (Ovis) Argali Pall. Taf. IX. Fig. 1— 3.
Bei den Mongolen der hohen Gobi: Argalei.
Bei den Kosaken der m ongolo-danrischen Hoehsteppen: dutcili cmenntM 6apam (mildes Steppenschaf.
Bei den S’ojpten und B u rjaten des oberen Irkntlaufes, die es ans dem D archatenlande
kennen: Ugulde.
Die B irar-T u ngn sen kannten es als im SW. vom Bureja-Gebirge vorkommend und nannten
es ukir, eine Bezeichnung, die eigentlich dem Binde in m ongolischer Sprache gebahrt.
1) Zoogr. ross.-astc. T. I, p. 194.
Schinz zieht. Ae gor. Argali Pall zur Capra Ammon L.; Capra Ammon L. wird aber von
den meisten Zoologen mit: 0. musimon Schreb., d. h. mit Aegoc. musimon Pall identificirt.
Jedenfalls ist Aeg. Argali Pall eine gute, Centralasien und einem Theile seines Nordrandes
eigenthümliche Art, die selbst vom nahestehenden Aeg. montanus Desm. auf das Deutlichste
zu unterscheiden ist.
Wie wir später sehen werden, so ist das Argal-Schaf seit dem Winter 1831— 32 nicht
mehr in den südlichsten Grenzländem D auriens anzutreffen und fehlt dem ganzen weitem
Osten Sibiriens gleichfalls. Nur den Schädel sammt den Hörnern eines'recht, alten Bockes
brachte ich mit und vergleiche diesen mit ändern und dem eines Aeg. montanus Desm. (nivi-
colaEsch), welchen H. W osnessenski in K am tschatka erbeutete und welchem ein Alter
von 14— 15 Jahren zuznschreiben wäre.
Herr v. M iddendorf f') hat bereits die Vergleiche der Homer beider Arten angestellt.
Den Charakter, dass sich die Aussenfläche des Homes bei Aeg. montanus beiderseits im
rechten Winkel zu den Seitenflächen umlegt, sehe ich am kam tschatkischen alten Bocke
gleichfalls. Der Aussenrand ist darin noch schärfer abgesetzt, als der Innenrand, indem die
seitliche Aussenwand hier senkrecht in der untern Homhälfte gerichtet ist und nur ihrem
oberen Rande entlang von etwas gerundeter Kante seicht überwölbt wird. Die seitliche
Innenfläche des Horns hat bei dem alten Bocke des Aeg. montanus eine solche Kante nicht,
vielmehr ist sie sehr schwach gewölbt (ich spreche immer nur von der Basalhälfte des Hor-
nes) und legt sich so an die Vorderfläche des Homes. Nur am Grunde desselben macht sich
eine gewölbte Leiste, die nach hinten hin bald verschwindet, deutlich.
Bei dem alten Bocke des Aeg. Argali aus dem Centralheile S ibiriens findet gewisser-
massen das Gegentheil in der Bildung der Ränder der Vorderseite statt. Denn an dem von
mir mitgebrachten Schädel sehe ich den Aussenrand der vorderen Homseite sich schief und
allmählich im Bogen zur äussem Seitenfläche neigen; den Innenrand etwas deutlicher pro-
noncirt, aber nicht senkrecht zur innem Seitenfläche abfallen, sondern sich mit dieser, die
gleichfalls leicht gewölbt ist, im Bogen vereinigen. Bei einem noch älteren der in der Akademie
bewahrten Argal-Schädel (aus der ehemaligen sogenannten Kunstkammer) finde ich
im Ganzen genommen ganz analoge Hornbildung, nur sind die Ränder an der Basis des Aussen
und Innenrandes gleich hoch und setzen sich im Basaltheile des Hornes etwas deutlicher
von den Randkanten ab, indem die runzlich gestalteten Ringe des Hörnes seitlich von tiefer
Längsfurche durchsetzt sind.
Die Unterschiede in den Enden des Homes zwischen dem kam tschatkisch en wilden
Schafe und dem Argal sind nicht minder in die Augen fallend. Bei dem ersteren werden
sie nie seitlich zusammengedrückt und flach, bleiben im Querdurchschnitt breit und tragen
keine zu Leisten prononcirte Kanten. Bei dem Argal .gewinnt das Hom in seiner Spitze
an Breite, d. h. der Durchmesser von einem Rande zum ändern ist verhältnissmässig viel
i) Sieb. Reis 1.c 117.