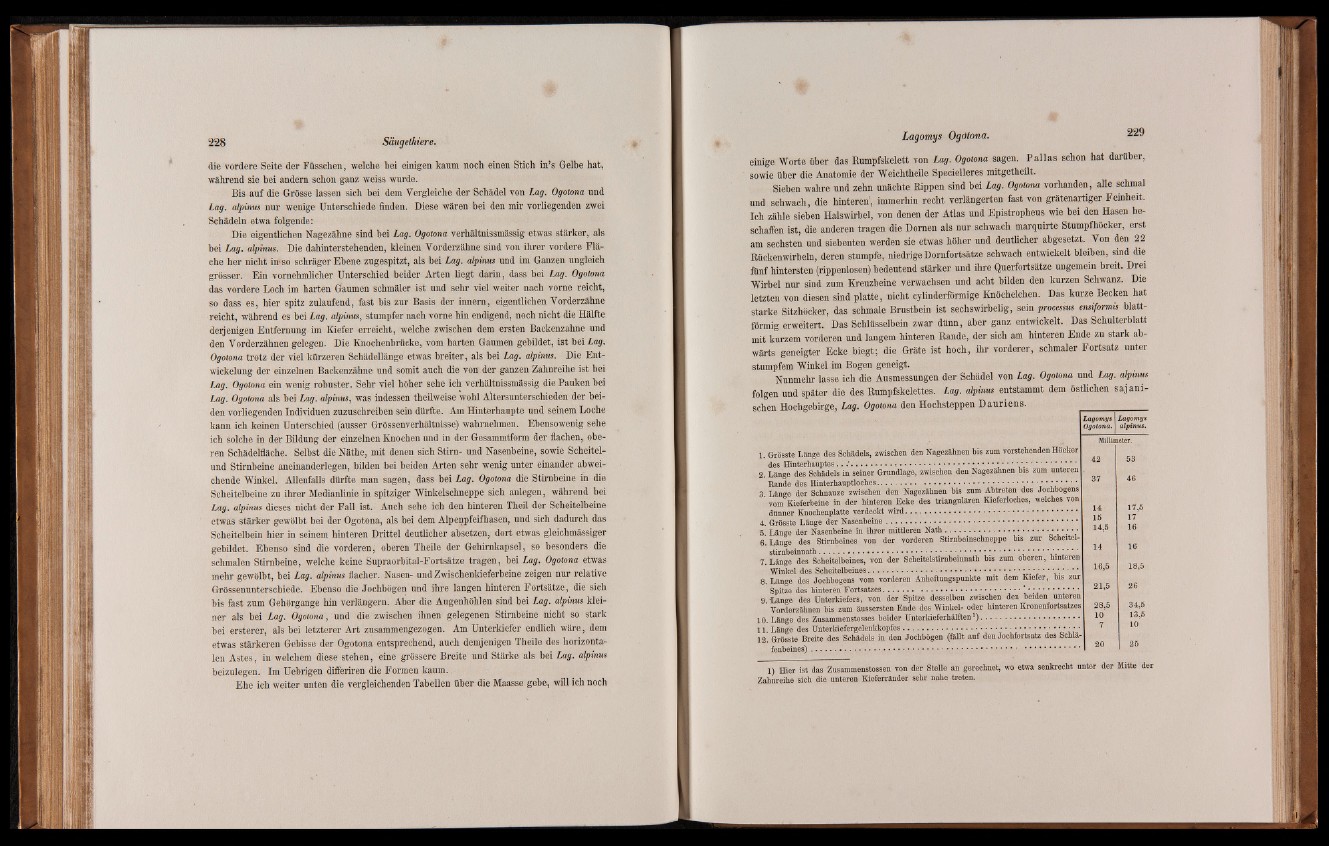
die vordere Seite der Füsschen, welche bei einigen kaum noch einen Stich in’s Gelbe hat,
während sie hei ändern schon ganz weiss wurde.
Bis auf die Grösse lassen sich hei dem Vergleiche der Schädel von Lag. Ogotona und
Lag. alpinus nur wenige Unterschiede finden. Diese wären bei den mir vorliegenden zwei
Schädeln etwa folgende:
Die eigentlichen Nagezähne sind bei Lag. Ogotona verhältnissmässig etwas stärker, als
hei Lag. alpinus. Die dahinterstehenden, kleinen Vorderzähne sind von ihrer vordere Fläche
her nicht imso schräger Ebene zugespitzt, als hei Lag. alpinus und im Ganzen ungleich
grösser. Ein vomehmlicher Unterschied beider Arten liegt darin, dass bei Lag. Ogotona
das vordere Loch im harten Gaumen schmäler ist und sehr viel weiter nach vorne reicht,
so dass es, hier spitz: zulaufend, fast bis zur Basis der innem, eigentlichen Vorderzähne
reicht, während es bei Lag. alpinus, stumpfer nach vorne hin endigend, noch nicht die Hälfte
derjenigen Entfernung im Kiefer erreicht, welche zwischen dem ersten Backenzahne und
den Vorderzähnen gelegen. Die Knochenbrücke, vom harten Gäumen gebildet, ist bei Lag.
Ogotona trotz der viel kürzeren Schädellänge etwas breiter, als bei Lag. alpinus. Die Entwickelung
der einzelnen Backenzähne und somit auch die von; der ganzen Zahnreihe ist bei
Lag. Ogotona ein wenig robuster. Sehr viel höher sehe ich verhältnissmässig die Pauken bei
Lag. Ogotona als bei Lag. alpinus, was indessen theilweise wohl Altersunterschieden der beiden
vorliegenden Individuen zuzuschreiben sein dürfte. Am Hinterhaupte und seinem Loche
kann ich keinen Unterschied (ausser Grössenverhältnisse) wahmehmen. Ebensowenig sehe
ich solche in der Bildung der einzelnen Knochen und in der Gesammtform der flachen, oberen
Schädelfläche. Selbst die Näthe, mit denen sich Stirn- und Nasenbeine, sowie Scheitelund
Stirnbeine aneinanderlegen, bilden bei beiden Arten sehr wenig unter einander abweichende
"Winkel. Allenfalls dürfte man sagen, dass bei Lag. Ogotona die Stirnbeine in die
Scheitelbeine zu ihrer Medianlinie in spitziger "Winkelschneppe sich anlegen, während bei
Lag. alpinus dieses nicht der Fall ist. Anch sehe ich den hinteren Theil der Scheitelbeine
etwas stärker gewölbt bei der Ogotona, als bei dem Alpenpfeifhasen, und sich dadurch das
Scheitelbein hier in seinem hinteren Drittel deutlicher ahsetzen, dort etwas gleichmässiger
gebildet. Ebenso sind die vorderen,' oberen Theile der Gehirnkapsel, so besonders die
schmalen Stirnbeine, welche keine Supraorbital-Fortsätze tragen, bei Lag. Ogotona etwas
mehr gewölbt, bei Lag. alpinus flacher. Nasen- und Zwischenkieferbeine zeigen nur relative
Grössenunterschiede. Ebenso die Jochbögen und ihre langen hinteren Fortsätze, die sich
bis fast zum Gehörgange hin verlängern. Aber die Augenhöhlen sind bei Lag. alpinus kleiner
als bei Lag. Ogotona, und die zwischen ihnen gelegenen Stirnbeine nicht so stark
bei ersterer, als bei letzterer Art zusammengezogen. Am Unterkiefer endlich wäre, dem
etwas stärkeren Gebisse der Ogotona entsprechend, auch demjenigen Theile des horizontalen
Astes, in welchem diese stehen, eine grössere Breite und Stärke als bei Lag. alpinus
beizulegen. Im Uebrigen differiren die Formen kaum.
Ehe ich weiter unten die vergleichenden Tabellen über die Maasse gebe, will ich noch
einige Worte über das Rumpfskelett von Lag. Ogotona sagen. P allas schon hat darüber,
sowie über die Anatomie der Weichtheile Specielleres mitgetheilt.
Sieben wahre und zehn unächte Rippen sind bei Lag. Ogotona vorhanden, alle schmal
und schwach, die hinteren1, immerhin recht verlängerten fast von grätenartiger Feinheit.
Ich zähle sieben Halswirbel, von denen der Atlas und Epistropheus wie bei den Hasen beschaffen
ist, die anderen tragen die Dornen als nur schwach marqnirte Stumpfhöcker, erst
am sechsten und siebenten werden sie etwas höher und deutlicher abgesetzt. Von den 22
Rückenwirbeln, deren stumpfe, niedrige Dornfortsätze schwach entwickelt bleiben, sind die
fünf hintersten (rippenlosen) bedeutend stärker und ihre Querfortsätze ungemein breit. Drei
Wirbel nur sind zum Kreuzbeine verwachsen und acht bilden den kurzen Schwanz. Die
letzten von diesen sind platte, nicht cylinderförmige Knöchelchen. Das kurze Becken hat
starke Sitzhöcker, das schmale Brustbein ist sechswirbelig, sein processus ensiformis blattförmig
erweitert. Das Schlüsselbein zwar dünn, aber ganz entwickelt. Das Schulterblatt
mit kurzem vorderen und langem hinteren Rande, der sich am hinteren Ende zu stark abwärts
geneigter Ecke biegt; die Gräte ist hoch, ihr vorderer, schmaler Fortsatz unter
stumpfem Winkel im Bogen geneigt.
Nunmehr lasse ich die Ausmessungen der Schädel von Lag. Ogotona und Lag. alpinus
folgen und später die des Rumpfskelettes. Lag. alpinus entstammt dem östlichen satan ischen
Hochgebirge, Lag. Ogotona den Hochsteppen D auriens. ______________
1. Grösste Länge des Schädels, zwischen den Nagezähnen bis zum vorstehenden Höcker
des Hinterhauptes • •
2. Länge des Schädels in seiner Grundlage, zwischen den Nagezähnen bis zum unteren
Rande des Hinterhauptloches...................................................... ................3. Länge der Schnauze zwischen den Nagezähnen bis zum Abtreten d e• s• ■Joc•h•b••o•g•e •n s■
vom Kieferheine in der hinteren Ecke des triangulären Kieferloches, welches von
dünner Knochenplatte verdeckt wird....................................................................................
4. Grösste Länge der Nasenbeine........................................................................ .....................
5. Länge der Nasenbeine in ihrer mittleren Nath ............ .. ...............| B
6. Länge des Stirnbeines von der vorderen Stirnbeinschneppe bis zur Scheitel7.
sLtäirnngbee idnensa tShc heitelbeines, von der Scheitelstirnbeinnat•h • •bi;s. ..z..u..m.... ..o.•b.e..r..e..n..,. .Yhi n* t’e ‘r e‘n
Winkel des Scheitelbeines....................................................................... • • • • • * • * *
8. Länge des Jochbogens vom vorderen Anheftungspunkte mit dem Kiefer, bis zur
Spitze des hinteren Fortsatzes....................................................................*•; • • • • • • • • •
9. -Länge des Unterkiefers, von der Spitze desselben zwischen den beiden unteren
Yorderzähnen bis zum äussersten Ende des Winkel- oder hinteren Kronenfortsatzes
10. Länge des Zusammenstosses beider Unterkieferhälftenl) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1112.. LGärnögsset ed eBsr eUitnet edreksi eSfecrhgäedleelnsk ikno pdfeens ..J.o...c..h..h..ö..g..e..n... ..(.f..ä..l.t. ..a.uMf dBePn JBofclhBfoBrtsaatMz dBes BSc*h•l ä*fenbeines)
. . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • • i ♦ • • • • • * * *
Lagomys
Ogotona.
Lagomys
alpinus.
Millii leter.
42 53
37 46
14
15
14,5
17,5
17
16
14 16
16,5 18,5
2i,5 26
28,5
107
34.5
13.5
10
20 25
1) Hier ist das Zusammenstossen von der Stelle an gerechnet, wo etwa senkrecht unter der Mitte der
Zahnreihe sich die unteren Kieferränder sehr nahe treten.