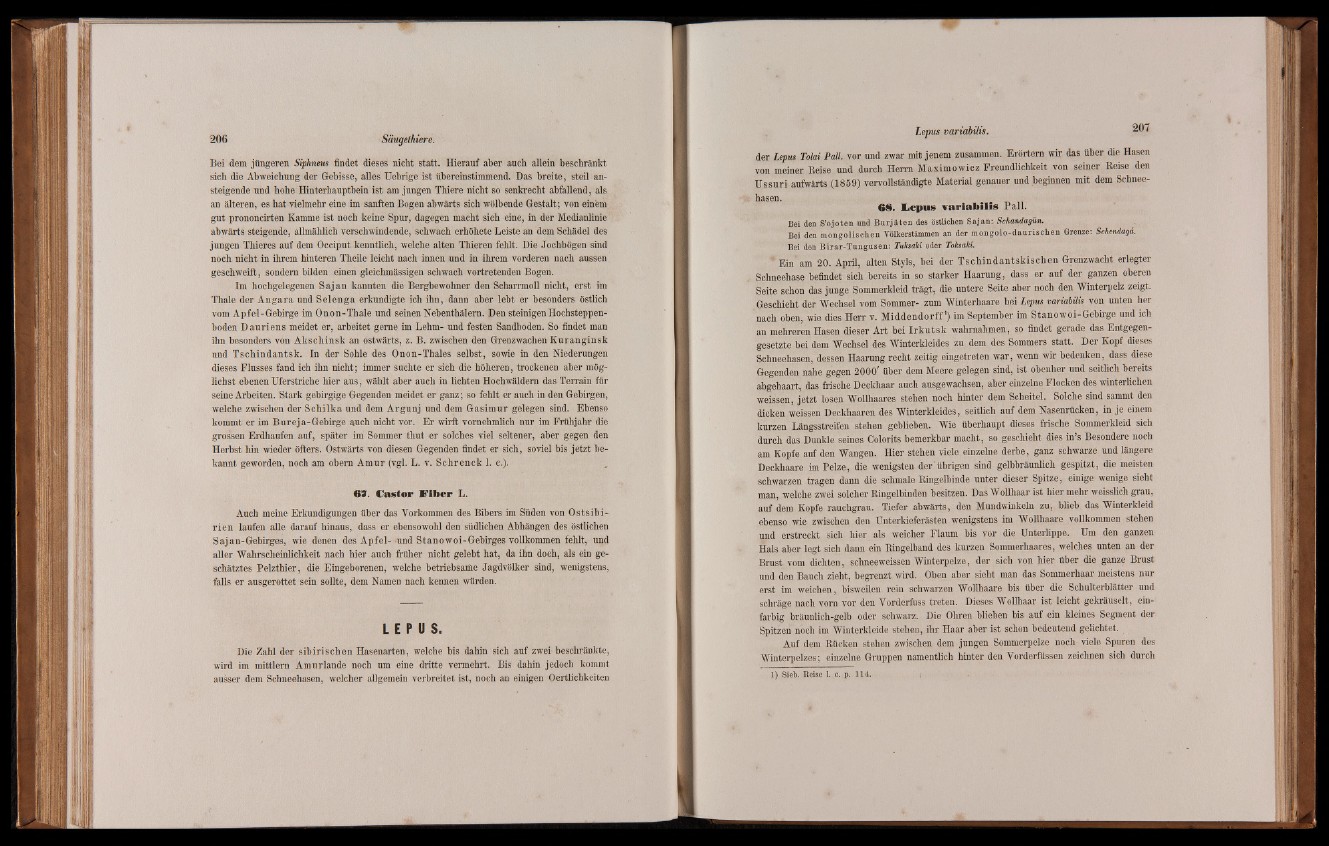
Bei dem jüngeren Siphneus findet dieses nicht statt. Hierauf aber auch allein beschränkt
sich die Abweichung der Gebisse, alles Uehrige ist übereinstimmend. Das breite, steil ansteigende
und hohe Hinterhauptbein ist am jungen Thiere nicht so senkrecht abfallend, als
an älteren, es hat vielmehr eine im sanften Bogen abwärts sich wölbende Gestalt; von einem
gut prononcirten Kamme ist noch keine Spur, dagegen macht sich eine, in der Medianlinie
abwärts steigende, allmählich verschwindende, schwach erhöhete Leiste an dem Schädel des
jungen Thieres auf dem Occiput kenntlich, welche alten Thieren fehlt. Die Joehbögen sind
noch nicht in ihrem hinteren Theile leicht nach innen und in ihrem vorderen nach aussen
geschweift, sondern bilden einen gleichmässigen schwach vortretenden Bogen.
Im hochgelegenen Sajan kannten die Bergbewohner den Scharrmoll nicht, erst im
Thale der A ngara und Selenga erkundigte ich ihn, dann aber lebt er besonders östlich
vom Apfel-Gebirge im Onon-Thale und seinen Nebenthälern. Den steinigen Hochsteppenboden
D auriens meidet er, arbeitet gerne im Lehm- und festen Sandboden. So findet man
ihn besonders von A kschinsk an ostwärts, z. B. zwischen den Grenzwachen K uranginsk
und Tschindantsk. In der Sohle des Onon-Thales selbst, sowie in den Niederungen
dieses Flusses fand ich ihn nicht; immer suchte er sich die höheren, trockenen aber möglichst
ebenenUferstriche hier aus, wählt aber auch in lichten Hochwäldern das Terrain für
seine Arbeiten. Stark gebirgige Gegenden meidet er ganz; so fehlt er auch in den Gebirgen,
welche zwischen der S chilka und dem Argunj und dem G asim ur gelegen sind. Ebenso
kommt er im Bureja-Gebirge auch nicht vor. Er wirft vornehmlich nur im Frühjahr die
grossen Erdhaufen auf, später im Sommer thut er solches viel seltener, aber gegen den
Herbst hin wieder öfters. Ostwärts von diesen Gegenden findet er sich, soviel bis jetzt bekannt
geworden, noch am obem Amur (vgl. L. v. Schrenck 1. c.).
69. Castor Fiber L.
Auch meine Erkundigungen über das Vorkommen des Bibers im Süden von O stsib irien
laufen alle darauf hinaus, dass er ebensowohl den südlichen Abhängen des östlichen
Sajan-Gebirges, wie denen des Apfel- und Stanowoi-Gebirges vollkommen fehlt, und
aller Wahrscheinlichkeit nach hier auch früher nicht gelebt hat, da ihn doch, als ein geschätztes
Pelzthier, die Eingeborenen, welche betriebsanle Jagdvölker sind, wenigstens,
falls er ausgerottet sein sollte, dem Namen nach kennen würden.
L E P U S.
Die Zahl der sibirischen Hasenarten, welche bis dahin sich auf zwei beschränkte,
wird im mittlern Amurlande noch um eine dritte vermehrt. Bis dahin jedoch kommt
ausser dem Schneehasen, welcher allgemein verbreitet ist, noch an einigen Oertlichkeiten
der Lepus Tolai Pall, vor und zwar mit jenem zusammen. Erörtern wir das über die Hasen
von meiner Eeise und durch Herrn Maximowicz Freundlichkeit von seiner Reise den
ü ssu ri aufwärts (1859) vervollständigte Material genauer und beginnen mit dem Schneehasen.
68. lep u s variabilis Pall.
Bei den S’ojoten und B u rjaten des östlichen Sajan:, Schandagün.
Bei den m ongolischen Völkerstämmen an der m o ngolo-daurischen Grenze: Schmdago.
Bei den B irar-T ungusen: Tuksaki oder Toksaki.
* Ein' am 20. April, alten Styls, bei der T sehind antskischen Grenzwacht erlegter
Schneehase befindet sich bereits in so starker Haarung, dass er auf der ganzen oberen
Seite schon das junge Sommerkleid trägt, die untere Seite aber noch den Winterpelz zeigt.
Geschieht der Wechsel vom Sommer- zum Winterhaare bei Lepus variatilis von unten her
nach oben, wie dies Herr v. Middendorff*|am September im Stanowoi-Gebirge und ich
an mehreren Hasen dieser Art hei Irk u tsk wahrnahmen, so findet gerade das Entgegengesetzte
hei dem Wechsel des Winterkleides zu dem des Sommers statt. Der Kopf dieses
Schneehasen, dessen Haarung recht zeitig eingetreten war, wenn wir bedenken, dass diese
Gegenden nahe gegen 2000' über dem Meere gelegen sind, ist obenher und seitlich bereits
abgehaart, das frische Deckhaar auch ausgewachsen, aber einzelne Flocken des winterlichen
weissen, jetzt losen Wollhaares stehen noch hinter dem Scheitel. Solche sind sammt den
dicken weissen Deckhaaren des Winterkleides, seitlich auf dem Nasenrücken, in je einem
kurzen Längsstreifen stehen gebliehen. Wie überhaupt dieses frische Sommerkleid sich
durch das Dunkle seines Colorits bemerkbar macht, so geschieht dies in’s Besondere noch
am Kopfe auf den Wangen. Hier stehen viele einzelne derbe, ganz schwarze und längere
Deckhaare im Pelze, die wenigsten der'übrigen sind gelbbräunlich gespitzt, die meisten
schwarzen tragen dann die schmale Ringelbinde unter dieser Spitze, einige wenige sieht
man, welche zwei solcher Ringelhinden besitzen. Das Wollhaar ist hier mehr weisslich grau,
auf dem Kopfe rauchgrau. Tiefer abwärts, den Mundwinkeln zu, blieb, das Winterkleid
ebenso wie zwischen den Unterkieferästen wenigstens im Wollhaare .vollkommen stehen
und erstreckt sich hier als weicher Flaum bis vor die Unterlippe. Um den ganzen
Hals abep legt sich dann ein Ringelband des kurzen Sommerhaares, welches unten an der
Brust vom dichten, schneeweissen Winterpelze, der sich von hier über die ganze Brust
und den Bauch zieht, begrenzt wird. Oben aber sieht man das Sommerhaar meistens nur
erst im weichen, bisweilen rein schwarzen Wollhaare bis über die Schulterblätter und
schräge nach vorn vor den Vorderfuss treten. Dieses Wollhaar ist leicht gekräuselt, einfarbig
bräunlich-gelb oder schwarz. Die Ohren blieben bis auf ein kleines Segment der
Spitzen noch im Winterkleide stehen, ihr Haar aber ist schon bedeutend gelichtet.
Auf dem Rücken stehen zwischen dem jungen Sommerpelze noch viele Spuren des
Winterpelzes; einzelne Gruppen namentlich hinter den Vorderfüssen zeichnen sich durch
1) Sieb. Eeise 1. c. p. 114.