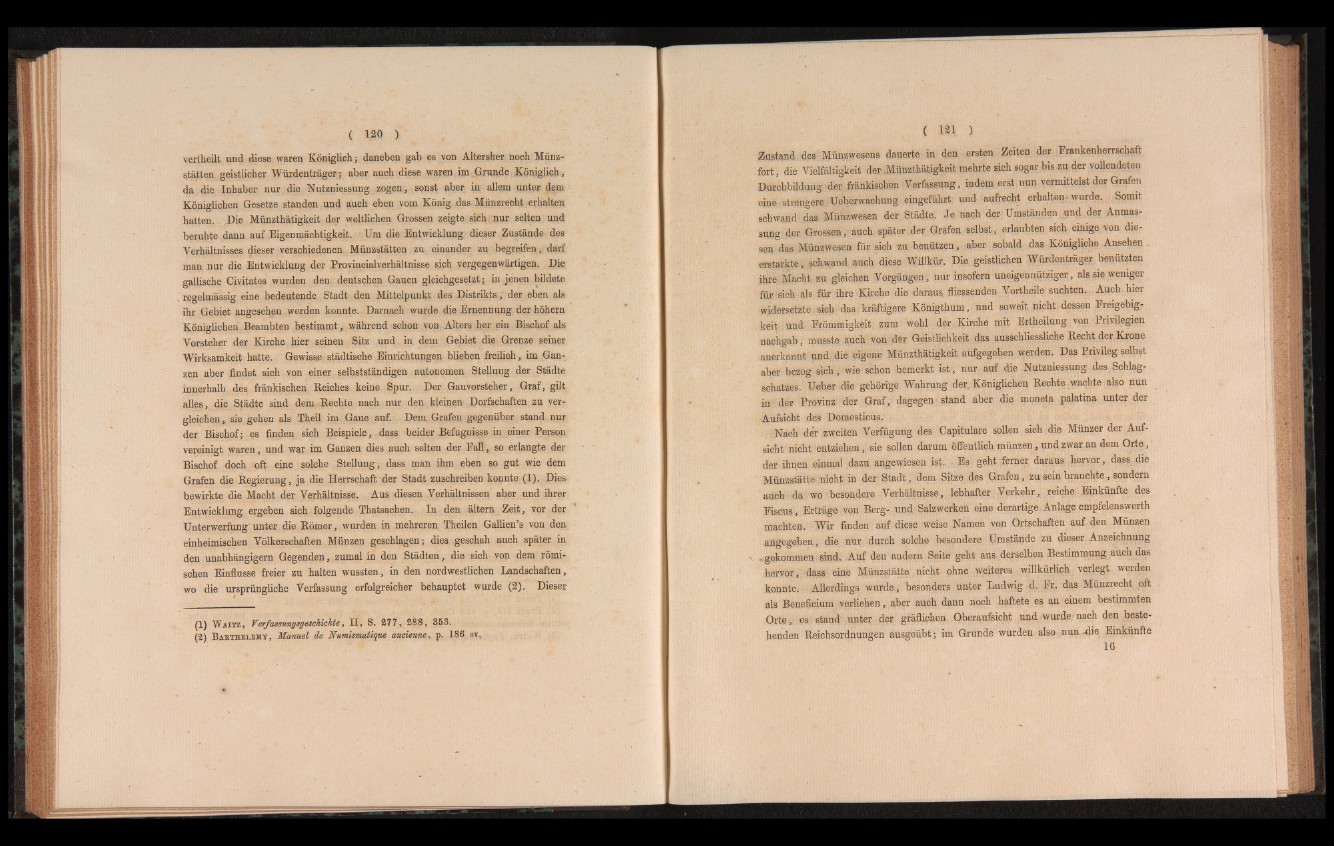
vertheilt und diese waren Königlich; daneben gab es von Altersher noch Münzstätten
geistlicher Würdenträger; aber auch diese waren im Grunde Königlich,
da die Inhaber nur die Nutzniessung zogen, sonst aber in allem unter dem
Königlichen Gesetze standen und auch eben vom König das Münzrecht erhalten
hatten. Die Münzthätigkeit der weltlichen Grossen zeigte sich nur selten und
beruhte dann auf Eigenmächtigkeit. Um die Entwicklung dieser Zustände des
Verhältnisses dieser verschiedenen Münzstätten zu einander zu begreifen, darf
man nur die Entwicklung der Provincialverhältnisse sich vergegenwärtigen. Die
gallische Civitates wurden den deutschen Gauen gleichgesetzt; in jenen bildete
regelmässig eine bedeutende Stadt den Mittelpunkt des Distrikts, der eben als
ihr Gebiet angesehen werden konnte. Darnach wurde die Ernennung der höhern
Königlichen Beambten bestimmt, während schon von Alters her ein Bischof als
Vorsteher der Kirche hier seinen Sitz und in dem Gebiet die Grenze seiner
Wirksamkeit hatte. Gewisse städtische Einrichtungen blieben freilioh, im Ganzen
aber findet sich von einer selbstständigen autonomen Stellung der Städte
innerhalb des fränkischen Reiches keine Spur. Der Gauvorsteher, Graf, gilt
alles, die Städte sind dem Rechte nach nur den kleinen Dorfschaften zu vergleichen
, sie gehen als Theil im Gaue auf. Dem Grafen gegenüber stand nur
der Bischof; es finden sich Beispiele, dass beider Befugnisse in einer Person
vereinigt waren, und war im Ganzen dies auch selten der Pall, so erlangte der
Bischof doch oft eine solche Stellung, dass man ihm eben so gut wie dem
Grafen die Regierung, ja die Herrschaft der Stadt zuschreiben konnte (1). Dies
bewirkte die Macht der Verhältnisse. Aus diesen Verhältnissen aber und ihrer
Entwicklung ergeben sich folgende Thatsachen. In den ältern Zeit, vor der
Unterwerfung' unter die Römer, wurden in mehreren Theilen Gallien’s von den
einheimischen Völkerschaften Münzen geschlagen; dies geschah auch später in
den unabhängigem Gegenden, zumal in den Städten, die sich von dem römischen
Einflüsse freier zu halten wussten, in den nordwestlichen Landschaften,
wo die ursprüngliche Verfassung erfolgreicher behauptet wurde (2). Dieser
(1) W a itz , Verfassungsgeschichte, I I , S. 277, 288, S58.
(2) Ba rth é lém y , Manuel de Numismatique ancienne, p. 186 sv,
Zustand des Münzwesens dauerte in den ersten Zeiten der Prankenherrschaft
fort, die Vielfältigkeit der .Münzthätigkeit mehrte sich sogar bis zu der vollendeten
Durchbildung der fränkischen Verfassung, indem erst nun vermittelst der Grafen
eine strengere Ueberwachung eingeführt und aufrecht erhalten-wurde. Somit
schwand das Münzwesen der Städte. Je nach der Umständen und der Anmas-
sung der Grossen, auch später der Grafen selbst, erlaubten sich einige von diesen
das Münzwesen für sich zu benützen, aber sobald das Königliche Ansehen
erstarkte, ach wand auch diese Willkür. Die geistlichen Würdenträger benützten
ihre Macht zu gleichen Vorgängen', nur insofern uneigennütziger, als sie weniger
für sich als für ihre Kirche die daraus fliessenden Vortheile suchten. Auch hier
widersetzte sich das kräftigere Königthum, nnd soweit nicht dessen Freigebigkeit
und Frömmigkeit zum wohl der Kirche mit Ertheilung von Privilegien
nachgab, musste auch von der Geistlichkeit das ausschliessliche Recht der Krone
anerkannt und die eigene Münzthätigkeit aufgegeben werden. Das Privileg selbst
aber bezog sich, wie schon bemerkt ist, nur auf die Nutzniessung des Schlagschatzes.
Ueber die gehörige Wahrung der. Königlichen Rechte wachte also nun
in der Provinz der Graf, dagegen stand aber die moneta palatina unter der
Aufsicht des Domesticus.
Nach der zweiten Verfügung des Capitulare sollen sich die Münzer der Aufsicht
nicht entziehen, sie sollen darum öffentlich münzen, und zwar an dem Orte,
der ihnen einmal dazu angewiesen ist. Es geht ferner daraus hervor, dass die
Münzstätte nicht in der Stadt, dem Sitze des Grafen, zu sein brauchte, sondern
auch da wo besondere Verhältnisse, lebhafter Verkehr, reiche Einkünfte des
Fiscus, Erträge von Berg- und Salzwerken eine derartige Anlage empfelenswerth
machten. Wir finden auf diese weise Namen von Ortschaften auf den Münzen
angegeben, die nur durch solche besondere Umstände zu dieser Anzeichnung
\ - gekommen sind. Auf den ändern Seite geht a u s derselben Bestimmung auch das
hervor, dass eine Münzstätte nicht ohne weiteres willkürlich verlegt werden
konnte. Allerdings wurde, besonders unter Ludwig d. Fr. das Münzrecht oft
als Beneficium verliehen, aber auch dann noch haftete es an einem bestimmten
Orte , es stand unter der gräflichen Oberaufsicht und wurde nach den bestehenden
Reichsordnungen ausgeübt; im Grunde wurden also nun -die Einkünfte
16