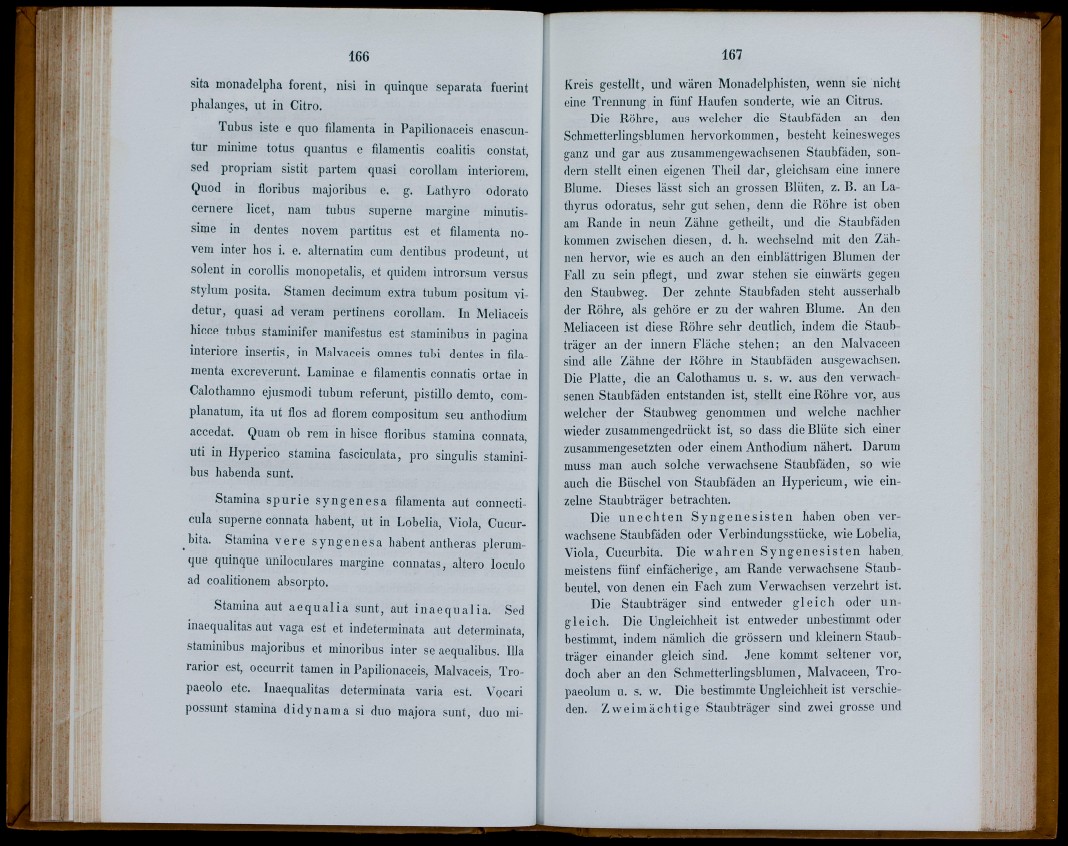
' 11
^ t ^
uj -
f
•' 1J
f'-i
166
sita monadelpha forent, nisi in quinque separata fuerint
phalanges, ut in Citro.
Tubus iste e quo filamenta in Papilionaceis enascuntur
minime totus quantus e filamentis coalitis constat,
sed propriam sistit partem quasi corollam interiorem.
Quod in floribus majoribus e. g, Lathyro odorato
cernere licet, nam tubus superne margine minutissime
in dentes novem partitus est et filamenta novem
inter hos i. e. alternatim cum dentibus prodeunt, ut
Solent in corollis monopetalis, et quidem introrsum versus
stylum posita. Stamen decimum extra tubum positum videtur,
quasi ad veram pertinens corollam. In Meliaceis
liicce tubus staminifer manifestus est staminibus in pagina
interiore insertis, in Malvaceis omnes tubi dentes in filamenta
excreverunt. Laminae e filamentis connatis ortae in
Calothamno ejusmodi tubum referunt, pistillo demto, complanatum,
ita ut flos ad florem compositum seu antliodium
accedat. Quam ob rem in hisce floribus stamina connata,
uti in Hyperico stamina fasciculata, pro singulis staminibus
habenda sunt.
Stamina spurie syngenesa filamenta aut connecticula
superne connata habent, ut in Lobelia, Viola, Cucurbita.
Stamina ver e syngenesa habent antheras plerumque
quinque uniloculares margine connatas, altero loculo
ad coalitionem absorpto.
Stamina aut aequal i a sunt, aut inaequalia. Sed
inaequalitas aut vaga est et indeterminata aut determinata,
staminibus majoribus et minoribus inter se aequalibus. Ilia
rarior est, occurrit tamen in Papilionaceis, Malvaceis, Tropaeolo
etc. Inaequalitas determinata varia est. Vocari
possunt stamina didynama si duo majora sunt, duo mi-
167
Kreis gestellt, und wären Monadelphisten, wenn sie nicht
eine Trennung in fünf Haufen sonderte, wie an Citrus.
Die Röhre, aus welcher die Staubfäden an den
Schmetterlingsblumen hervorkommen, besteht keinesweges
ganz und gar aus zusammengewachsenen Staubfäden, sondern
stellt einen eigenen Theil dar, gleichsam eine innere
Blume, Dieses lässt sich an grossen Blüten, z. B. an Lathyrus
odoratus, sehr gut sehen, denn die Röhre ist oben
am Rande in neun Zähne getheilt, und die Staubfäden
kommen zwischen diesen, d. h. wechselnd mit den Zähnen
hervor, wie es auch an den einblättrigen Blumen der
Fall zu sein pflegt, und zwar stehen sie einwärts gegen
den Staubweg. Der zehnte Staubfaden steht ausserhalb
der Röhre, als gehöre er zu der wahren Blume. An den
Meliaceen ist diese Röhre sehr deutlich, indem die Staubträger
an der innern Fläche stehen; an den Malvaceen
sind alle Zähne der Röhre in Staubfäden ausgewachsen.
Die Platte, die an Calothamus u. s. w, aus den verwachsenen
Staubfäden entstanden ist, stellt eine Röhre vor, aus
welcher der Staubweg genommen und welche nachher
wieder zusammengedrückt ist, so dass die Blüte sich einer
zusammengesetzten oder einem Anthodium nähert. Darum
muss man auch solche verwachsene Staubfäden, so wie
auch die Büschel von Staubfäden an Hypericum, wie einzelne
Staubträger betrachten.
Die unechten Syngenesisten haben oben verwachsene
Staubfäden oder Verbindungsstücke, wie Lobelia,
Viola, Cucurbita. Die wahren Syngenesisten haben
meistens fünf einfächerige, am Rande verwachsene Staubbeutel,
von denen ein Fach zum Verwachsen verzehrt ist.
Die Staubträger sind entweder gleich oder ung
l e i c h . Die Ungleichheit ist entweder unbestimmt oder
bestimmt, indem nämlich die grössern und kleinern Staubträger
einander gleich sind. Jene kommt seltener vor,
doch aber an den Schmetterlingsblumen, Malvaceen, Tropaeolum
u. s. w. Die bestimmte Ungleichheit ist verschieden.
Zweimächtige Staubträger sind zwei grosse und