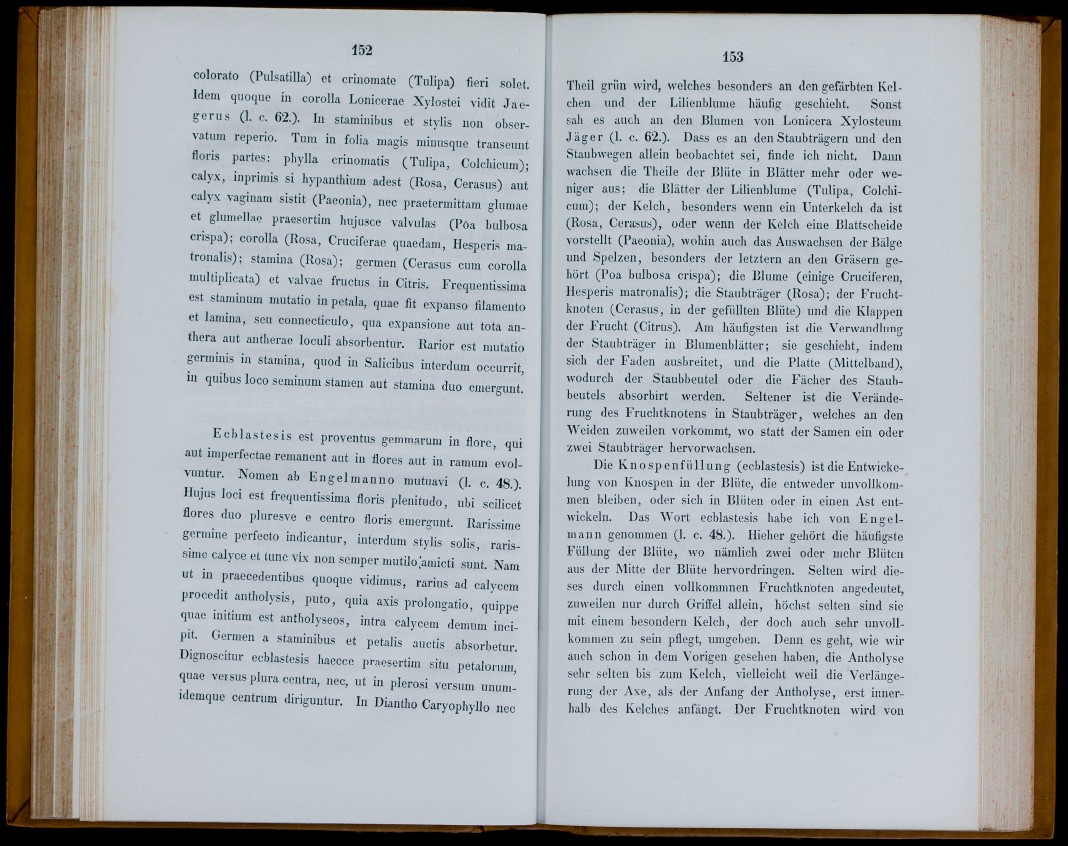
II 'i:
I'
•! r s
£ -
-f .
' . i f
colorato (Pulsatilla) et crinomate (Tulipa) fieri solet.
Idem quoque in corolla Lonicerae Xylostei vidit Jaeg
e r u s (1. c. 62.). In staminibus et stylis non observatuin
reperio. Tum in folia magis minusque transenni
flons partes: phylla crinomatis (Tulipa, Colchicum);
calyx, inprimis si liypantliium adest (Rosa, Cerasus) aut
calyx vaginam sistit (Paeonia), nec praetermittam glumae
et glumellae praesertim hujusce valvulas (Poa bulbosa
crispa); corolla (Rosa, Cruciferae quaedam, Hesperis matronalis);
stamina (Rosa); germen (Cerasus cum corolla
nmltiplicata) et yalvae fructus in Citris. Frequentissima
est staminum mutatio in petala, quae fit expanso filamento
et lamina, seu connecticulo, qua expansione ant tota anthera
aut antherae loculi absorbentur. Rarior est mutatio
8-ermmis in stamina, quod in Salicibus interdum occurrit,
111 quibus loco seminum stamen aut stamina duo emergunt'
E c b l a s t e s i s est proventus gemmarum in flore, qui
aut imperfectae remanent aut in flores aut in ramum evolvuntur.
Nomen ab Engelmanno mutuavi (1. e. 48)
Hujus loci est frequentissima floris plenitudo, ubi scilicet
flores duo pluresve e centro floris emergunt. Rarissime
germuae perfecto indicantur, interdum stylis solis raris
sime calyce et tunc vix non semper mutilo[amicti sunt. Nam
ut in praecedentibus quoque vidimus, rarius ad calycem
procedit antholysis, puto, quia axis prolongatio, quippe
quae initium est antholyseos, intra calycem demum incipit.
Germen a staminibus et petalis auctis absorbetnr
Dignoscitur ecblastesis Laecce praesertim situ petalorum
quae versus plura centra, nec, ut in plerosi versum unumidemque
centrum diriguntur. In Diantho Caryophyllo nec
Tlieil grün wird, welches besonders an den gefärbten Kelchen
und der Lilienblume häufig geschieht. Sonst
sah es auch an den Blumen von Lonicera Xylostenm
J ä g e r (1. c. 62.). Dass es an den Staub trägem und den
Staubwegen allein beobachtet sei, finde ich nicht. Dann
wachsen die Theile der Blüte in Blätter mehr oder weniger
aus; die Blätter der Lilienblume (Tulipa, Colchicum);
der Kelch, besonders wenn ein Unterkelch da ist
(Rosa, Cerasus), oder wenn der Kelch eine Blattscheide
vorstellt (Paeonia), wohin auch das Auswachsen der Bälge
und Spelzen, besonders der letztern an den Gräsern gehört
(Poa bulbosa crispa); die Blume (einige Cruciferen,
Hesperis matronalis); die Staubträger (Rosa); der Fruchtknoten
(Cerasus, in der gefüllten Blüte) und die Klappen
der Frucht (Citrus). Am häufigsten ist die Verwandlung
der Staubträger in Blumenblätter; sie geschieht, indem
sich der Faden ausbreitet, und die Platte (Mittelband),
wodurch der Staubbeutel oder die Fächer des Staubbeutels
absorbirt werden. Seltener ist die Veränderung
des Fruchtknotens in Staubträger, welches an den
Weiden zuweilen vorkommt, wo statt der Samen ein oder
zwei Staubträger hervorwachsen.
Die Knospenfül lung (ecblastesis) ist die Entwickelung
von Knospen in der Blüte, die entweder unvollkommen
bleiben, oder sich in Blüten oder in einen Ast entwickeln.
Das Wort ecblastesis habe ich von Engelmajin
genommen (1. c. 48.). Hieher gehört die häufigste
Füllung der Blüte, wo nämlich zwei oder mehr Blüten
aus der Mitte der Blüte hervordringen. Selten wird dieses
durch einen vollkommnen Fruchtknoten angedeutet,
zuweilen nur durch Griffel allein, höchst selten sind sie
mit einem besondern Kelch, der doch auch sehr unvollkommen
zu sein pflegt, umgeben. Denn es geht, wie wir
auch schon in dem Vorigen gesehen haben, die Antholyse
sehr selten bis zum Kelch, vielleicht weil die Verlängerung
der Axe, als der Anfang der Antholyse, erst innerhalb
des Kelches anfängt. Der Fruchtknoten wird von
»