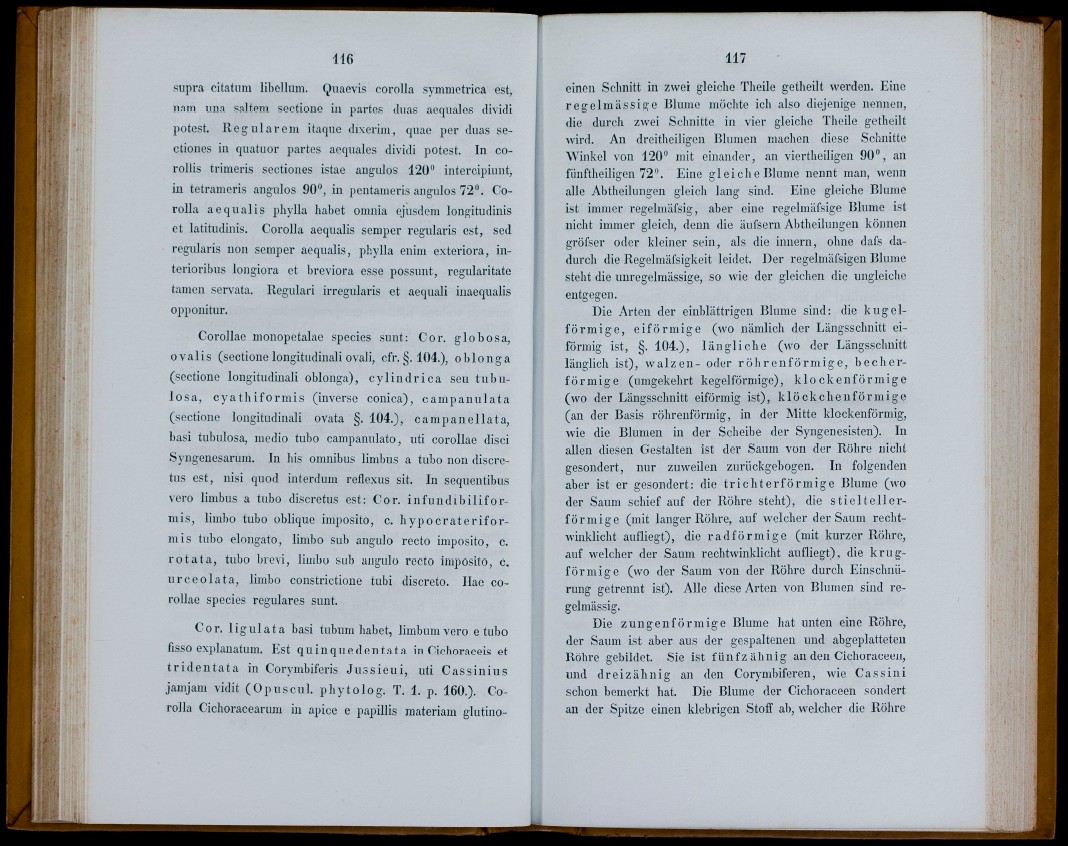
J 11' V
116
supra citatum libellum. Quaevis corolla symmetrica est,
nam una saltem sectione in partes oluas aequales dividi
potest. Regulärem itaque dixerim, quae per duas sectiones
in quatuor partes aequales dividi potest. In corollis
trimeris sectiones istae ángulos 120^ intercipiunt^
in tetrameris ángulos 90^ in pentameris ángulos 72^. Corolla
a e q u a l is phylla habet omnia ejusdem longitudinis
et latitudinis. Corolla aequalis semper regularis est, sed
regularis non semper aequalis, phylla enim exteriora, interioribus
longiora et breviora esse possunt, regularitate
tamen servata. Regulari irregularis et acquali inaequalis
opponitur.
Corollae monopetalae species sunt: Cor. globosa,
o v a l i s (sectione longitudinali ovali, cfr. §. 104.), oblonga
(sectione longitudinali oblonga), cylindrica seu tubul
o s a , cyathiformis (inverse conica), campanulata
(sectione longitudinali ovata §. 104.), campanellata,
basi tubulosa, medio tubo campanulato, uti corollae disci
Syngenesarum. In his omnibus limbus a tubo non discretus
est, nisi quod interdum reflexus sit. In sequentibus
vero limbus a tubo discretus est: Cor. infundibilifornáis,
limbo tubo oblique imposito, c. hypocrateriformis
tubo elongato, limbo sub ángulo recto imposito, c.
r o t a t a , tubo brevi, limbo sub ángulo recto imposito, e.
u r c e o l a t a , limbo constrictione tubi discreto. Hae corollae
species regulares sunt.
Cor. l igulat a basi tubum habet, limbum vero e tubo
fisso explanatum. Est quinquedentata in Cichoraceis et
t r i d e n t a t a in Corymbiferis Jussieui, uti Cassinius
jamjam vidit (Opuscul . phytolog. T. 1. p. 160.). Corolla
Cichoracearum in apice e papillis materiam glutino-
117
einen Schnitt in zwei gleiche Theile getheilt werden. Eine
r e g e l m ä s s i g e Blume möchte ich also diejenige nennen,
die durch zwei Schnitte in vier gleiche Theile getheilt
wird. An dreitheiligen Blumen machen diese Schnitte
Winkel von 120^ mit einander, an viertheiligen 90®, an
fiinftheiligen Eine gleiche Blume nennt man, wenn
alle Abtheilungen gleich lang sind. Eine gleiche Blume
ist immer regelmäfsig, aber eine regelmäfsige Blume ist
nicht immer gleich, denn die äufsern Abtheilungen können
gröfser oder kleiner sein, als die innern, ohne dafs dadurch
die Regelmäfsigkeit leidet. Der regelmäfsigen Blume
steht die unregelmässige, so wie der gleichen die ungleiche
entgegen.
Die Arten der einblättrigen Blume sind: die kugelf
ö r m i g e , eiförmige (wo nämlich der Längsschnitt eiförmig
ist, §. 104.), längliche (wo der Längsschnitt
länglich ist), walzen- oder röhrenförmige, becherf
ö r m i g e (umgekehrt kegelförmige), klockenförmige
(wo der Längsschnitt eiförmig ist), klöckchenförmige
(an der Basis röhrenförmig, in der Mitte klockenförmig,
wie die Blumen in der Scheibe der Syngenesisten). In
allen diesen Gestalten ist der Saum von der Röhre nicht
gesondert, nur zuweilen zurückgebogen. In folgenden
aber ist er gesondert: die t r ichter förmige Blume (wo
der Saum schief auf der Röhre steht), die stieltellerf
ö r m i g e (mit langer Röhre, auf welcher der Saum rechtwinklicht
aufliegt), die radförmige (mit kurzer Röhre,
auf welcher der Saum rechtwinklicht aufliegt), die krugf
ö r m i g e (wo der Saum von der Röhre durch Einschnürung
getrennt ist). Alle diese Arten von Blumen sind regelmässig.
Die zungenförmige Blume hat unten eine Röhre,
der Saum ist aber aus der gespaltenen und abgeplatteten
Röhre gebildet. Sie ist fünfz ähni g an den Cichoraceen,
und dreizähnig an den Corymbiferen, wie Cassini
schon bemerkt hat. Die Blume der Cichoraceen sondert
an der Spitze einen klebrigen Stoff ab, welcher die Röhre
• •. "J <