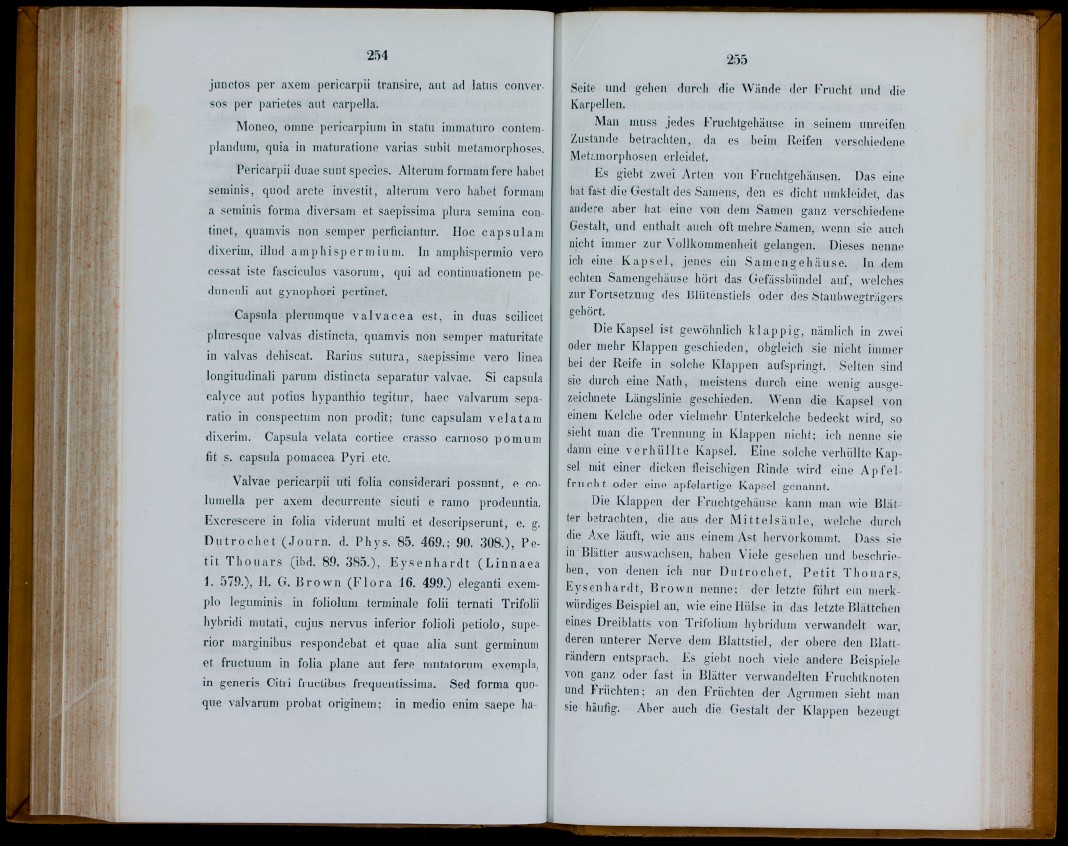
J .
„J.J J
I
; . •
I
I :
I
i
jC, • • =
I
ir".' -
• .
. ••fJ.i ./
- ^ It
254
jiinctos per axeni pericarpi! transire, avit ad latus convorsos
per parietes aiit carpella.
Monco, onine pericarpiiini in statu innnaturo contcmplanduni,
quia in niaturatione varias subit metamorphoses.
Pericarpii duae sunt species. Alteram formam fere habet
seminis, quod arete investit, alteram vero habet formam
a seminis forma diversam et saepissima plura semina continet,
quamvis non semper perficiantur. Hoc capsulam
dixerim, illud amphisp e rm ium. In amphispermio vero
cessât iste fasciculus vasoruni, qui ad contimiationem pe^
dunculi aut gynophori pertinet.
Capsula plerumqne valvacea est, in duas scilicet
pluresque valvas distincta, quamvis non semper maturitate
in valvas dehiscat. Rarius sutura, saepissime vero linea
longitudinali parum distincta separatur valvae. Si capsula
calyce aut potius hypanthio tegitur, haec valvarum separatio
in conspectum non prodit; tunc capsulam velatam
dixerim. Capsula velata cortice crasso carnoso pomum
fit s. capsula pomacea Pyri etc.
Valvae pericarpii uti folia considerari possunt, e columella
per axem deciirrente sicuti e ramo prodeuntia.
Excrescere in folia viderunt multi et descripserunt, e, g,
D u t r o c h e t (Journ. d. Phys. 85. 469.; 90. 308.), Pet
i t Thouar s (ibd. 89. 385.), Eysenhardt (Linnaea
1. 579.), II. G. B r o w n (Flora 16. 499.) eleganti exemplo
leguminis in foliolum terminale folii ternati Trifolii
hybridi mutati, cujus nervus inferior folioli petiolo, superior
marginibus respondebat et quae alia sunt germinum
et fructuum in folia plane aut fere mutatorum exempla,
in generis Citri fructibus frequentissima. Sed forma quoque
valvarum probat originem; in medio enim saepe ha-
255
Seite und gehen (hirch die Wände der Frucht und die
Karpellen.
Man muss jedes Fruchtgehäuse in seinen) unreifen
Zustande betrachten, da es beim Reifen verschiedene
Metamorphosen erleidet.
Es giebt zwei Arten von Fruchtgehäusen. Das eine
hat fast die Gestalt des Samens, den es dicht umkleidet, das
andere aber hat eine von dem Samen ganz verschiedene
Gestalt, und enthält auch oft mehre Samen, wenn sie auch
nicht immer zur Vollkommenheit gelangen. Dieses nenne
ich eine Kapsel, jenes ein Samengehäuse. In dem
echten Samengehäuse hört das Gefässbiindel auf, welches
zur Fortsetzung des Bliitenstiels oder des Staubwegträgers
gehört.
Die Kapsel ist gewöhnlich klappig, nämlich in zwei
oder mehr Klappen geschieden, obgleich sie nicht immer
bei der Reife in solche Klappen aufspringt. Selten sind
sie durch eine Nath, meistens durch eine wenig ausgezeichnete
Längslinie geschieden. Wenn die Kapsel von
einem Kelche oder vielmehr Unterkelche bedeckt wird, so
sieht man die Trennung in Klappen nicht; ich nenne sie
dann eine v e rhül l t e Kapsel. Eine solche verhüllte Kapsel
mit einer dicken fleischigen Rinde wird eine Apfelf
r u c h t oder eine apfelartige Kapsel genannt.
Die Klappen der Fruchtgehäuse kann man wie Blät-^
ter betrachten, die aus der Mi t telsäule, welche durch
die Axe läuft, wie aus einem Ast hervorkommt. Dass sie
in Blätter auswachsen, haben Viele gesehen und beschrieben,
von denen ich nur Dutrochet, Petit Thouars,
E y s e n h a r d t , Brown nenne; der letzte führt ein nterkwürdiges
Beispiel an, wie eine Hülse in das letzte Blättchen
eines Dreiblatts von Trifolium hybridum verwandelt war,
deren unterer Nerve dem Blattstiel, der obere den Blatträndern
entsprach. Es giebt noch viele andere Beispiele
von ganz oder fast in Blätter verwandelten Fruchtknoten
und Früchten; an den Früchten der Agrumen sieht man
sie häufig. Aber auch die Gestalt der Klappen bezeugt
M
"I