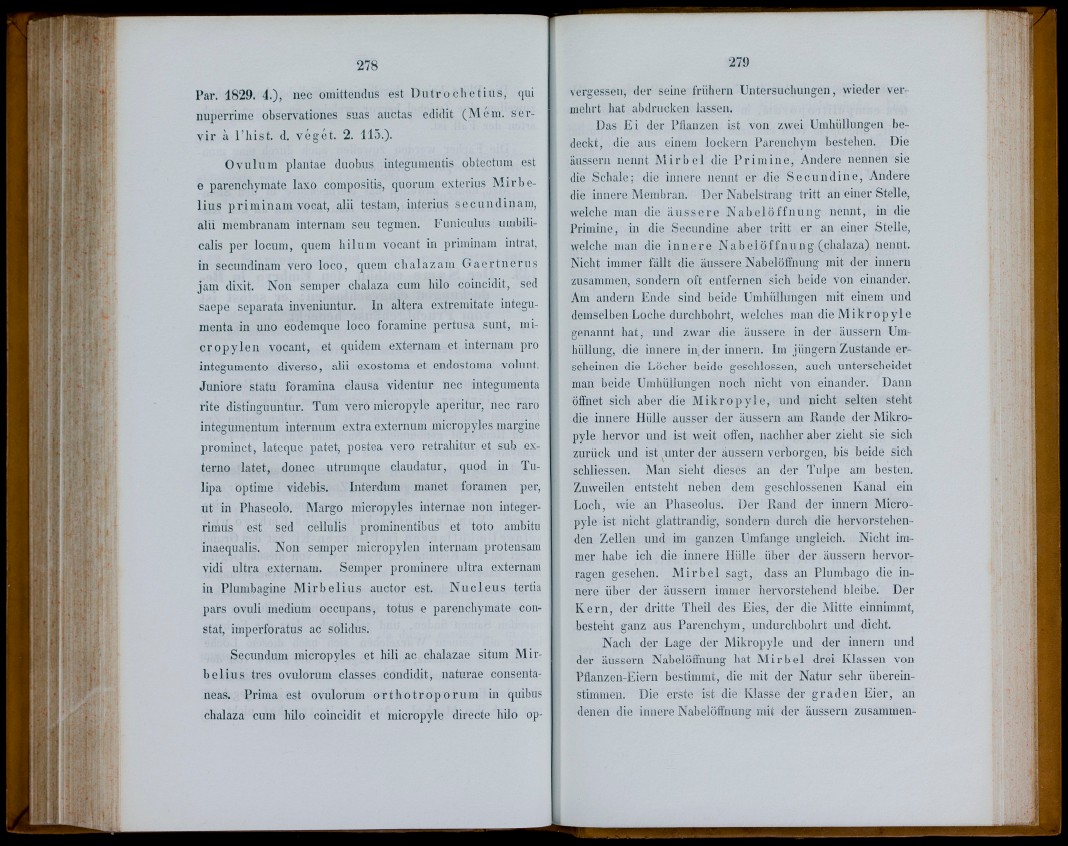
• í • •
w p, t . « ^ a-
I I • ' ^
278
Par. 1829. 4.)? iiec omitteiidus est Dutr o eh e t i u s , qui
imperrime observationes suas auctas edidit (Mcm. serv
i r à l'hist. d. végét . 2. 115.).
O v u l um plaiitae duobus integuiiieutis obíectum est
e parenchymate laxo compositis, quorum exterius Mirbel
i u s priminam vocat, alii testcim, iuterius secuudinam,
alii membranam internam seu tegmen. Funiculus umbilicalis
per locum, quem liilum vocant in priminam intrat,
in secundinam vero loco, quem clialazam Gacrtnerus
jam dixit. Non semper chalaza cum hilo coincidit, sed
saepe separata inveniuntur. in altera extremitate integumenta
in uno eodemque loco foramine pertusa sunt, mic
r o p y l e n vocant, et quidem externam et internam pro
integumento diverso, alii exostoma et endostoma volunt.
Juniore statu foramina clausa videntur nec integumenta
rite distinguuntur. Tum vero micropyle aperitur, nec raro
integumentum internum extra externum micropyles margine
prominet, lateque patet, postea vero retrahitur et sub externo
latet, donee utrumque claudatur, quod in Tulipa
optime videbis. Interdum manet foramen per,
ut in Phaseolo. Margo micropyles internae non integerrimus
est sed cellulis prominentibus et toto ambitu
inaequalis. Non semper micropylen internam protensam
vidi ultra externam. Semper prominei^e ultra externam
in Plumbagine Mirbelius auctor est Nucleus tertia
pars ovuli medium occupans, totus e parenchymate constatj
imperfor¿itus ac solidus.
Secundum micropyles et hili ac chalazae sitnm Mirb
e l i u s tres ovulorum classes condidit, naturae consentaneas.
Prima est ovulorum ortliotroporum in quibus
chalaza cum hilo coincidit et micropyle directe hilo op-
II
279
vergesseu, der seine frühem Untersuchungen, wieder vermehrt
hat abdrucken lassen.
Das Ei der Pflanzen ist von zwei Umhüllungen bedeckt,
die aus einem lockern Parenchym bestehen. Die
äussern nennt Mi rbel die P r imine, Andere nennen sie
die Schale; die innere nennt er die Secnndine, Andere
die innere Membran. Der Nabelstraug tritt an einer Stelle,
welche man die äusser e Nabelöffnuug nennt, in die
Primine, in die Secundine aber tritt er an einer Stelle,
welche man die inner e Nabelöffnung (chakiza) nennt.
Nicht immer fällt die äussere Nabelöffnung mit der innern
zusanunen, sondern oft entfernen sich l)eide von einander.
Am andern Ende sind beide Umhüllungen mit einem und
demselben Loche durchbohrt, welches man dieMikropyle
genannt hat, und zwar die äussere in der äussern Umhüllung,
die innere inderinnern. Im Jüngern Zustande erscheinen
die Löcher beide geschlossen, auch unterscheidet
man beide Uinhüllungen noch nicht von einander. Dann
öffnet sich aber die Mikropyle, und nicht selten steht
die innere Hülle ausser der äussern am Rande der Mikropyle
hervor und ist weit offen, nachher aber zieht sie sich
zurück und ist ^unter der äussern verborgen, bis beide sich
schliessen. Man sieht dieses an der Tulpe am besten.
Zuweilen entsteht neben dem geschlossenen Kanal ein
Loch, wie an Phaseolus. Der Rand der innern Micropyle
ist nicht glattrandig, sondern durch die hervorstehenden
Zellen und im ganzen Umfange ungleich. Nicht immer
habe ich die innere Hülle über der äussern hervorragen
gesehen. Mirbel sagt, dass an Plnmbago die innere
über der äussern immer hervorstehend bleibe. Der
K e r n , der dritte Theil des Eies, der die Mitte einnimmt,
besteht ganz aus Parenchym, undurchbohrt und dicht.
Nach der Lage der Mikropyle und der innern und
der äussern Nabelöffnung hat Mi rbel drei Klassen von
Pflanzen-Eiern bestimmt, die mit der Natur sehr übereinstimmen.
Die erste ist die Klasse der graden Eier, an
denen die innere Nabelöffnung mit der äussern zusammen-
M
A
wmmmmm^