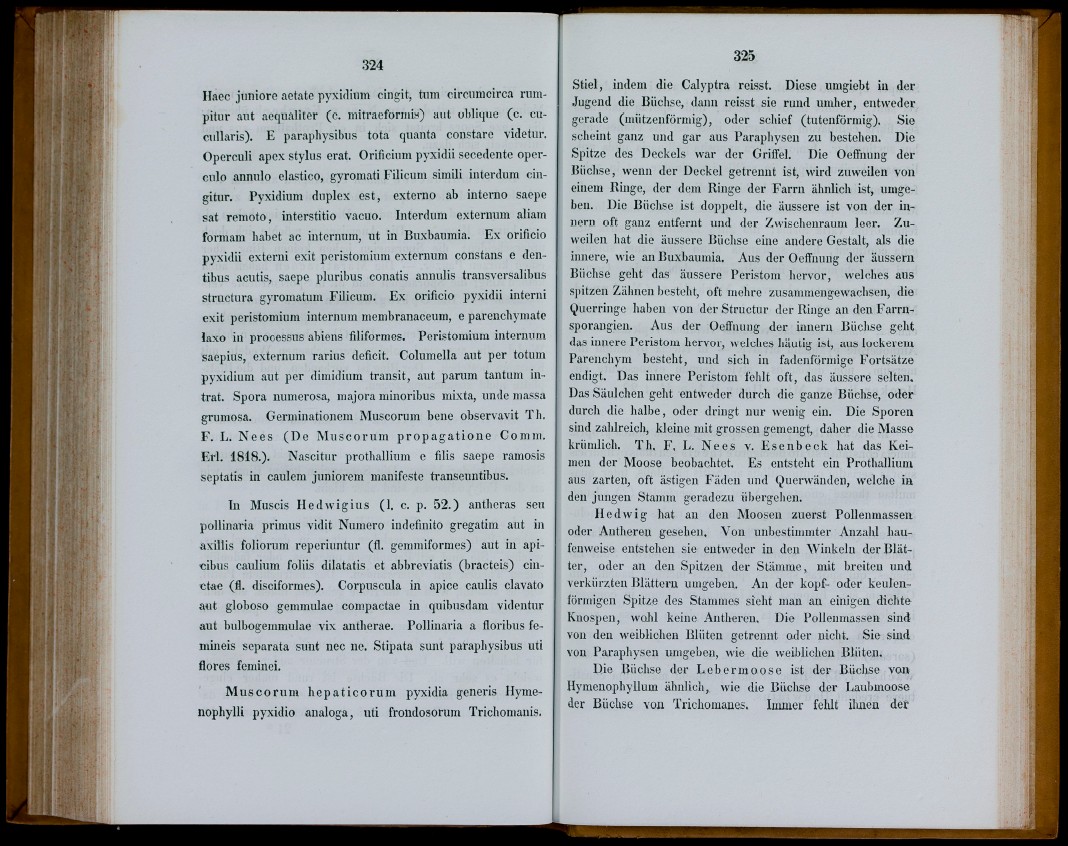
> ^ ?
t "
324
Ilaec juniore aetate pyxiclhim cingit, turn circiimcirca rumpitur
aut aequaliter (c. initraeformis) ant oblique (c. cucullaris).
E parapliysibus tota quanta constare vicletur,
Operculi apex stylus erat. Orificium pyxidii secedente operculo
annulo elastico, gyromati Filicum simili interdum cingitur.
Pyxidium duplex est, externo ab interno saepe
sat remoto, interstitio vacuo. Interdum externum aliam
formam habet ac internum, ut in Buxbaumia. Ex orificio
pyxidii externi exit peristomium externum constans e dentibus
acutis, saepe pluribus conatis annulis transversalibus
structura gyromatum Filicum. Ex orificio pyxidii interni
exit peristomium internum membranaceum, e parenchymate
iaxo in processus abiens filiformes. Peristomium internum
saepius, externum rarius deficit. Columella aut per totum
pyxidium aut per dimidium transit, aut parum tantum intrat.
Spora numerosa, majora minoribus mixta, unde massa
grumosa. Germinationem Muscorum bene observavit Th,
F. L. Nees (De Muscorum propagatione Comm.
Erl. 1818.). Nascitur prothallium e filis saepe ramosis
septatis in caulem juniorem manifeste transeuntibus.
In Muscis Hedwigius (1. c. p. 52.) antlieras sen
pollinaria primus vidit Numero indefinito gregatim aut in
axillis foliorum reperiuntur (fl. gemmiformes) aut in api-
<iibus caulium foliis dilatatis et abbreviatis (bracteis) einctae
(fl. disciformes). Corpuscula in apice caulis clavato
aut globoso gemmulae compactae in quibusdam videntur
aut bulbogemmulae vix antherae. Pollinaria a floribus femineis
separata sunt nec ne. Stipata sunt pataphysibus uti
flores feminei.
M u s c o r um hepaticorum pyxidia generis Hymenophylli
pyxidio analoga, uti frondosorum Trichomanis.
Stiel, indem die Calyptra reisst. Diese umgiebt ia der
Jugend die Büchse, dann reisst sie rund umher, entweder
gerade (miitzenförmig), oder schief (tutenförmig). Sie
scheint ganz und gar aus Paraphysen zu bestehen. Die
Spitze des Deckels war der Griffel. Die Oeffnung der
Büchse, wenn der Deckel getrennt ist, wird zuweilen von
einem Ringe, der dem Ringe der Farm ähnlich ist, umgeben.
Die Büchse ist doppelt, die äussere ist von der inneni
oft ganz entfernt und der Zwischenraum leer. Zuweilen
hat die äussere Büchse eine andere Gestalt, als die
innere, wie an Buxbaumia. Aus der Oeffnung der äussern
Büchse geht das äussere Peristom hervor, welches aus
spitzen Zähnen besteht, oft mehre zusammengewachsen, die
Querringe haben von der Structur der Ringe an den Farmsporangien.
Aus der Oeffnung der innera Büchse geht
das innere Peristom hervor, w^elches häutig ist, aus lockerem
Parenchym besteht, und sich in fadenförmige Fortsätze
endigt. Das innere Peristom fehlt oft, das äussere selten.
Das Säulchen geht entweder durch die ganze Büchse, oder
durch die halbe, oder dringt nur wenig ein. Die Sporen
sind zahlreich, kleine mit grossen gemengt, daher die Masse
krümlich, Th, F, L. Nees v, Esenbeck hat das Keimen
der Moose beobachtet Es entsteht ein Prothallium
aus zarten, oft ästigen Fäden und Querwänden, welche ia
den jungen Stamm geradezu übergehen.
Hedwig hat an den Moosen zuerst Pollenmasseii
oder Antheren gesehen. Von unbestimmter Anzahl haufenweise
entstehen sie entweder in den Winkeln der Blätter,
oder an den Spitzen der Stämme ^ mit breiten und
verkürzten Blättern umgeben. An der köpf- oder keulenförmigen
Spitze des Stammes sieht man an einigen dichte
Knospen, woJil keine Antheren. Die Pollenmassen sind
von den weiblichen Blüten getrennt ader nicht. Sie sind
von Paraphysen umgeben, wie die weiblichen Blüten,
Die Büchse der Lebermoose ist der Büchse van
Hymenophyllum ähnlich, wie die Büchse der Laubmoose
der Büchse von Trichomanes, Immer fehlt ihnen der