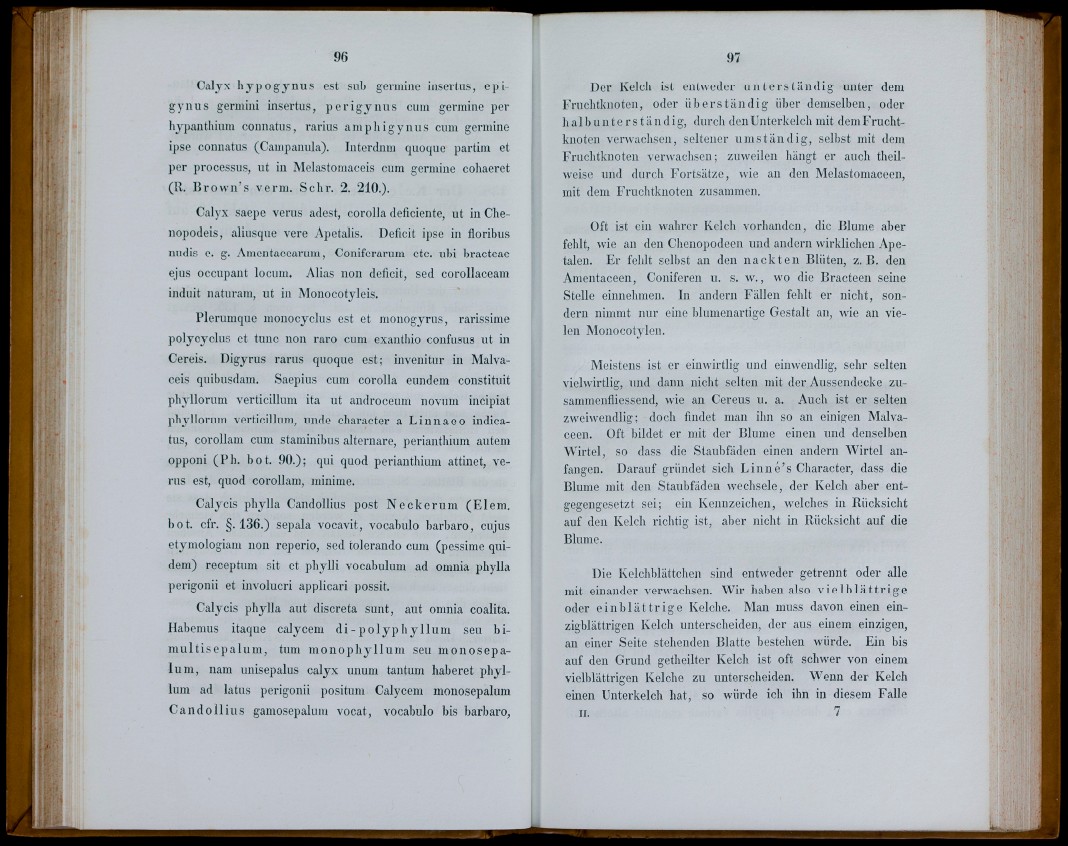
IFÎS'M' l-iüf'titti i
:r1
Î ?
• ^ r
i1i 'l'ir <tj ;. -. 4;' -"^K
? •• . '
r, : .
t I'V U t:. -1
96
Calyx h j p o g y n u s est sub germine insertusj epi
gynus geniiini insertus, perigjiins cum germiue per
hjpanthium counatus, rarius amplugynus cum germine
ipse coniiatus (Campauula), luterdnm quoque partim et
per processus, ut in Melastomaceis cum germine cohaeret
(R. Brown' s verm. Schr. 2. 210.).
Calyx saepe verus adest, corolla deficiente, ut in Chenopodeis,
aliusque vere Apetalis. Deficit ipse in floribus
nudis e. g. Amentacearum, Coniferarum etc. ubi bracteae
ejus occupant locunu Alias non deficit, sed corollaceam
induit naturam, ut in Monocotjleis.
Plerumque monocjclus est et monogyrus, rarissime
poljcyclus et tunc non raro cum exanthio confusus ut in
Cereis. Digyrus rarus quoque est; invenitur in Malvaceis
quibusdam. Saepius cum corolla eundem constituit
pliyllorum verticillum ita ut androceum novum incipiat
phyllorum verticillum, unde character a Linnaeo indicatus,
corollam cum staminibus alternare, perianthmm autem
opponi (Ph. bot. 90.); qui quod periantliium attinet, verus
est, quod corollam, minime.
Calycis phylla Candollius post Neckerum (Elem.
bot. cfr. §.136.) sepala vocavit, vocabulo barbaro, cujus
etymologiam non reperio, sed tolerando cum (pessime quidem)
receptum sit et phylli vocabulum ad omnia phylla
perigoni! et involucri applicari possit.
Calycis phylla aut discreta sunt, aut omnia coalita.
Habemus itaque calycem di-polyphyllum seu bim
u l t i s e p a l u m , turn monophyl lum seu monosepalum,
nam unisepalus calyx unum tantum haberet phyllum
ad latus perigonii positum Calycem monosepalum
C a n d o l l i u s gamosepalum vocat, vocabulo bis barbaro,
97
Der Kelch ist entweder unterständig unter dem
Fruchtknoten, oder üb e r s t ä n d i g über demselben, oder
h a i b u n t e rs t ändig, durch den Unterkelch mit dem Fruchtknoten
verwachsen, seltener umständig, selbst mit dem
Fruchtknoten verw^achsen; zuweilen hängt er auch theilweise
und durch Fortsätze, wie an den Melastomaceen,
mit dem Fruchtknoten zusammen.
Oft ist ein wahrer Kelch vorhanden, die Blume aber
fehlt, wie an den Chenopodeen und andern wirklichen Apetalen.
Er fehlt selbst an den nackten Blüten, z.B. den
Amentaceen, Coniferen u. s. w., wo die Bracteen seine
Stelle einnehmen. In andern Fällen fehlt er nicht, sondern
nimmt nur eine blumenartige Gestalt an, wie an vielen
Monocotylen.
Meistens ist er einwirtlig und einwendlig, sehr selten
vielwirtlig, und dann nicht selten mit der Aussendecke zusammenfliessend,
wie an Cereus u. a. Auch ist er selten
zweiwendlig; doch findet man ihn so an einigen Malvaceen.
Oft bildet er mit der Blume einen und denselben
Wirtel, so dass die Staubfäden einen andern Wirtel anfangen.
Darauf gründet sich Linne' s Character, dass die
Blume mit den Staubfäden wechsele, der Kelch aber entgegengesetzt
sei; ein Kennzeichen, welches in Rücksicht
auf den Kelch richtig ist, aber nicht in Rücksicht auf die
Blume.
Die Kelchblättchen sind entweder getrennt oder alle
mit einander verwachsen. Wir haben also vielblättrige
oder einblät t r ige Kelche. Man muss davon einen einzigblättrigen
Kelch unterscheiden, der aus einem einzigen,
an einer Seite stehenden Blatte bestehen würde. Ein bis
auf den Grund getheilter Kelch ist oft schwer von einem
vielblättrigen Kelche zu unterscheiden. Wenn der Kelch
einen Unterkelch hat, so würde ich ihn in diesem Falle
II. 7
i Ar..