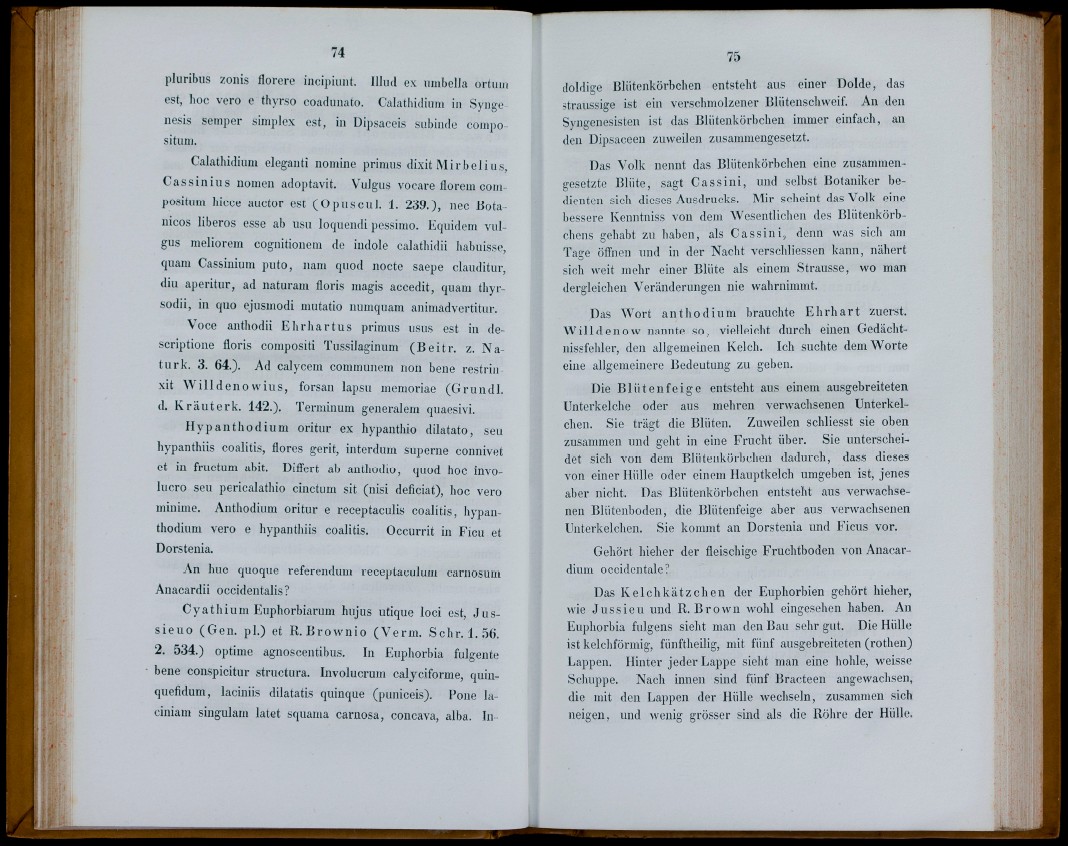
S '
74
pluribus zonis florere incipiuiit. lllud ex umbelJa ortuiii
est, hoc vero e thyrso coaduaato. Ciilathidium in Syiige
iiesis semper simplex est, in Dipsaceis subiiide composituili.
Calathidium eleganti nomine primus dixit Mi r bel i us,
C a s s i n i u s nomen adoptavit. Vulgus vocare florem compositum
hicce auctor est (Op us cui . 1. 239.), nec Bota--
iiicos liberos esse ab usu loquendi pessimo. Eqiiidem vulgus
meliorem Cognitionen! de indole calathidii Imbuisse,
quam Cassinium puto, nam quod nocte saepe clauditur,
diu aperitur, ad naturam floris magis accedit, quam tliyrsodii,
in quo ejusmodi mutatio numquam animadvertitur.
Voce anthodii Elirhartus primus usus est in de~
scriptione floris compositi Tussilaginum (Beitr. z. Nat
u r k. 3. 64.). Ad calycem communem non bene restrinxit
Willdenowins, forsan lapsu memoriae (Gründl,
d. Krauterk. 142.). Terminum generalem quaesivi.
H y p a n t h o d i um oritur ex hypantliio dilatato, seu
hypanthiis coalitis, flores gerit, interdum superne connivet
et in fructum abit. Differt ab anthodio, quod hoc involucro
seu pericalathio cinctum sit (nisi deficiat), hoc vero
minime. Anthodium oritur e receptaculis coalitis, hypanthodium
vero e hypanthiis coalitis. Occurrit in Ficu et
Dorstenia.
An hue quoque referendum receptaculum carnosum
Anacardii occidentals?
C y a t h i um Euphorbiarum hujus utique loci est, Juss
i e u o (Gen. pi.) et R. B r own i o (Verm. Sehr. 1.56.
2. 534.) optime agnoscentibus. In Euphorbia fulgente
bene conspicitur structura. Involucrum calyciforme, quinquefidum,
laciniis dilatatis quinque (puniceis). Pone laciniam
singulam latet squama carnosa, concava, alba. In-
75
doldige Blütenkörbchen entsteht aus einer Dolde, das
straussige ist ein verschmolzener Blütenschweif. An den
Syngenesisten ist das Bliitenkörbchen immer einfach, an
den Dipsaceen zuweilen zusammengesetzt.
Das Volk nennt das Bliitenkörbchen eine zusammengesetzte
Blüte, sagt Cassini, und selbst Botaniker bedienten
sich dieses Ausdrucks. Mir scheint das Volk eine
bessere Kenntniss von dem Wesentlichen des Bliiteiikörbchens
gehabt zu haben, als Cassini, denn was sich am
Tage öffnen und in der Nacht verschliessen kann, nähert
sich weit mehr einer Blüte als einem Strausse, wo man
dergleichen Veränderungen nie wahrnimmt.
Das Wort anthodium brauchte Ehrhart zuerst.
W i l l d e n o w nannte so, vielleicht durch einen Gedächtnissfehler,
den allgemeinen Kelch. Ich suchte dem Worte
eine allgemeinere Bedeutung zu geben.
Die Blütenfeige entsteht aus einem ausgebreiteten
Unterkelche oder aus mehren verwachsenen Unterkelchen.
Sie trägt die Blüten. Zuweilen schliesst sie oben
zusammen und geht in eine Frucht über. Sie unterscheidet
sich von dem Blütenkörbchen dadurch, dass dieses
von einer Hülle oder einem Hauptkelch umgeben ist, jenes
aber nicht. Das Blütenkörbchen entsteht aus verwachsenen
Blütenboden, die Blütenfeige aber aus verwachsenen
Unterkelchen. Sie kommt an Dorstenia und Ficus vor.
Gehört hieher der fleischige Fruchtboden von Anacardium
occidentale?
Das Kelchkätzchen der Euphorbien gehört hieher,
wie Jussieu und R.Brown wohl eingesehen haben. An
Euphorbia fulgens sieht man den Bau sehr gut. Die Hülle
ist kelchförmig, fünftheilig, mit fünf ausgebreiteten (rothen)
Lappen. Hinter jeder Lappe sieht man eine hohle, weisse
Schuppe. Nach innen sind fünf Bracteen angewachsen,
die mit den Lappen der Hülle wechseln, zusammen sich
neigen, und wenig grösser sind als die Röhre der Hülle.