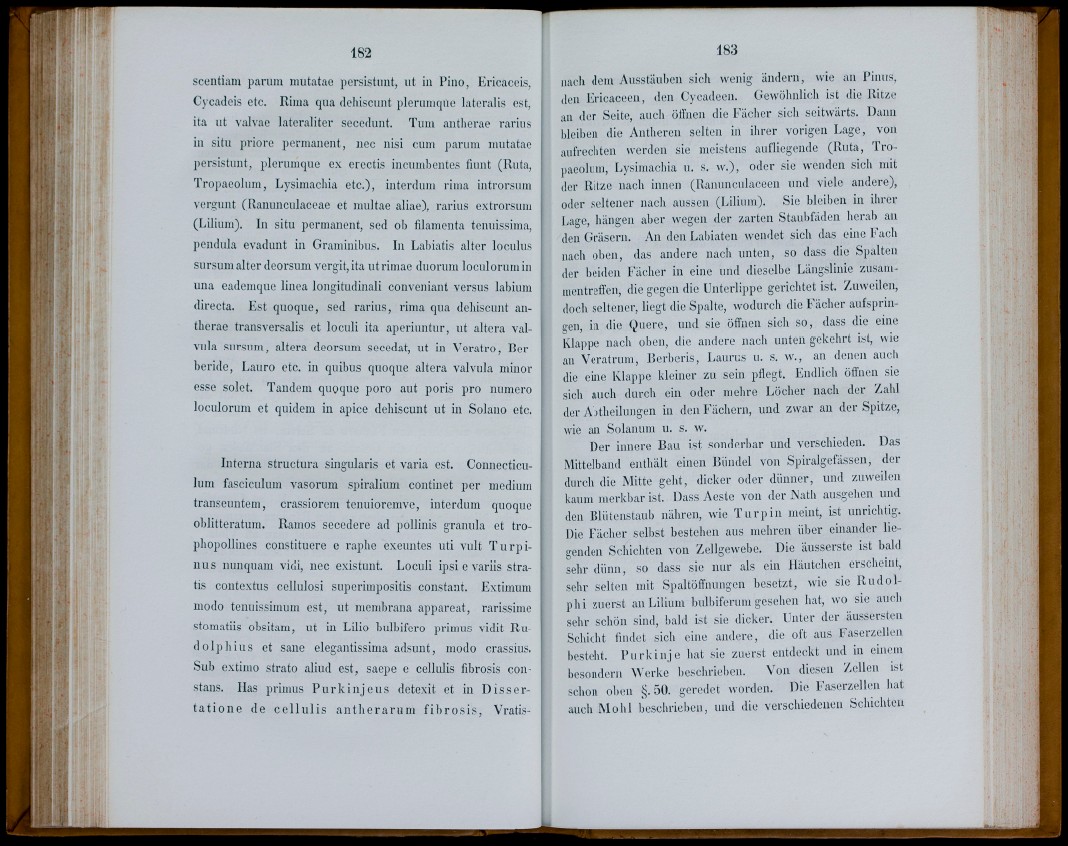
I t Ì it :
I
1
Ìk f
' : t
182
scentiain parum mutatae persistmit, ut in Pino, Ericaccis,
Cycadcis etc. Rima qua deliiscunt plernmqùe lateralis est,
ita ut valvae latoraliter secedunt. Tum antherae rarius
in situ priore permanent, nec nisi cum parum mutatae
persistunt, plerumque ex ercctis incumbentes fnint (Ruta,
Tropaeolum, Lysimachia etc.), interdum rima introrsum
vergunt (Ranunculaceae et multae aliae), rarius extrorsum
(Lilium), In situ permanent, sed ob filamenta tenuissima,
pendula evadunt in Graminibus. In Labiatis alter loculus
sursum alter deorsum vergit,ita utrimae duorum loculorumin
una eademque linea longitudinali conveniant versus labium
directa. Est quoque, sed rarius, rima qua deliiscunt antherae
transversalis et loculi ita aperinntur, ut altera valvula
sursum, altera deorsum secedat, ut in Veratro, Berberide,
Lauro etc. in quibus quoque altera valvula minor
esse solet. Tandem quoque poro aut poris pro numero
loculorum et quidem in apice deliiscunt ut in Solano etc.
Interna structura singularis et varia est. Connecticulum
fasciculuin vasorum spiralium continet per medium
transeuntem, crassiorem tenuioremve, interdum quoque
oblitteratum. Ramos secedere ad pollinis granula et tropliopollines
constituere e raphe exeuntes uti vult Turpinus
nunquam vidi, nec existunt. Loculi ipsi e variis stratis
contextus celluiosi superimpositis constant. Extimum
modo tenuissimum est, ut membrana appareat, rarissime
stomatiis obsitam, ut in Lilio bulbifero primus vidit Rud
o l p h i u s et sane elegantissima adsunt, modo crassius.
Sub extimo strato aliud est, saepe e cellulis fibrosis constans.
Has primus Purk inj e u s detexit et in Dissert
a t i o n e de cellulis antherarum fibrosis, Vratis-
183
nach dem Ausstäuben sich wenig ändern, wie an Pinus,
den Ericaceen, den Cycadeen. Gewöhnlich ist die Ritze
an der Seite, auch öffnen die Fächer sich seitwärts. Dann
bleiben die Antheren selten in ihrer vorigen Lage, von
aufrechten werden sie meistens aufliegende (Ruta, Tropaeolum,
Lysimachia u. s. w.), oder sie wenden sich mit
der Ritze nach innen (Ranunculaceen und viele andere),
oder seltener nach aussen (Lilium). Sie bleiben in ihrer
l.age, hängen aber wegen der zarten Staubfäden herab an
den Gräsern. An den Labiaten wendet sich das eine Fach
nach oben, das andere nach unten, so dass die Spalten
der beiden Fächer in eine und dieselbe Längslinie zusammentreffen,
die gegen die Unterlippe gerichtet ist. Zuweilen,
doch seltener, liegt die Spalte, wodurch die Fächer aufspringen,
in die Quere, und sie öffnen sich so, dass die eine
Klappe nach oben, die andere nach unten gekehrt ist, wie
an Veratrum, Berberis, Laurus u. s. w., an denen aucJi
die eine Klappe kleiner zu sein pflegt. Endlich öffnen sie
sich auch durch ein oder mehre Löcher nach der Zahl
der Abtheilungen in den Fächern, und zwar an der Spitze,
wie an Solanum u. s. w.
Der innere Bau ist sonderbar und verschieden. Das
Mittelband enthält einen Bündel von Spiralgefässen, der
durch die Mitte geht, dicker oder dünner, und zuweilen
kaum merkbar ist. Dass Aeste von der Nath ausgehen und
den Blütenstaub nähren, wie T u r p i n meint, ist unrichtig.
Die Fächer selbst bestehen aus mehren über einander liegenden
Schichten von Zellgewebe. Die äusserste ist bald
sehr dünn, so dass sie nur als ein Häutchen erscheint,
sehr selten mit Spaltöffnungen besetzt, wie sie Rudolphi
zuerst an Lilium bulbiferum gesehen hat, wo sie auch
sehr schön sind, bald ist sie dicker. Unter der äussersten
Schicht findet sich eine andere, die oft aus Faserzellen
besteht. Purkinje hat sie zuerst entdeckt und in einem
besondern Werlce beschrieben. Von diesen Zellen ist
schon oben §. 50. geredet worden. Die Faserzellen hat
auch Mo hl beschrieben, und die verschiedeneu Schichten
i 'r- i]'