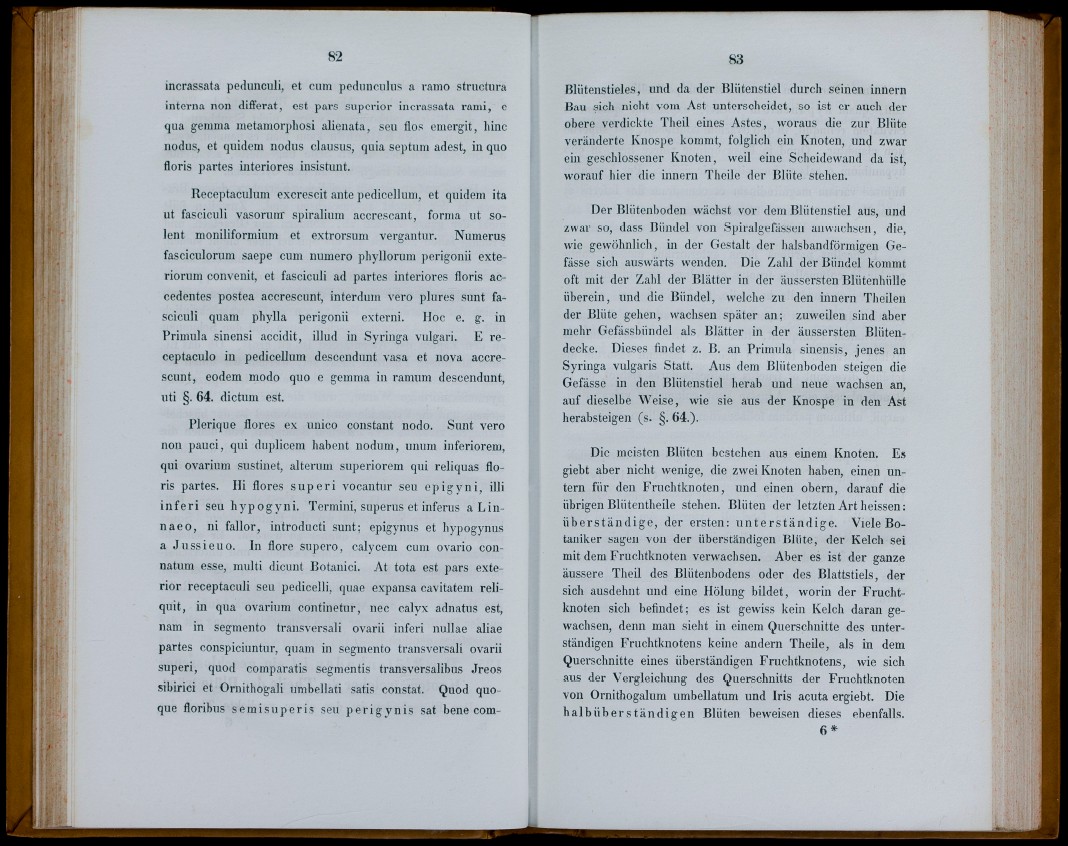
: ff.i'
82
incrassata pedimculi, et cum pednncnlns a ramo structura
interna non différât, est pars superior incrassata rami, e
qua gemma metamorphosi alienata, seu flos emergit, liinc
nodus, et quidem nodus clausus, quia septum adest, in quo
floris partes interiores insistunt.
Receptaculum excrescit ante pedicellum, et quidem ita
ut fasciculi vasorum~ spiralium accrescant, forma ut soient
moniliformium et extrorsum vergantur. Numerus
fasciculorum saepe cum numero phyllorum perigonii exteriorum
convenit, et fasciculi ad partes interiores floris accedentes
postea accrescunt, interdum vero plures sunt fasciculi
quam phylla perigonii externi. Hoc e. g. in
Primula sinensi accidit, illud in Syringa vulgari. E receptáculo
in pedicellum descendunt vasa et uova accrescunt,
eodem modo quo e gemma in ramum descendunt,
uti 64. dictum est.
Plerique flores ex unico constant nodo. Sunt vero
non pauci, qui duplicem habent nodum, unum inferiorem,
qui ovarium sustinet, alterum superiorem qui reliquas floris
partes. Hi flores superi vocantur seu epigyni, illi
i n f e r i seu hypogyni . Termini, superus et inferus a Linn
a e o , ni fallor, introducti sunt; epigynus et hypogynus
a Jussieuo. In flore supero, calycem cum ovario connatum
esse, multi dicunt Botanici. At tota est pars exterior
receptaculi seu pedicelli, quae expansa cavitatem reliquit,
in qua ovarium continetur, nec calyx adnatus est,
nam in segmento transversali ovarii inferi nullae aliae
partes conspiciuntur, quam in segmento transversali ovarii
superi, quod comparatis segmentis transversalibus Jreos
sibirici et Ornithogali umbellati satis constat. Quod quoque
floribus semisuperis seu per igyni s sat bene com-
83
Bliitenstieles, und da der Bliitenstiel durch seinen innern
Bau sich nicht vom Ast unterscheidet, so ist er auch der
obere verdickte Theil eines Astes, woraus die zur Blüte
veränderte Knospe kommt, folglich ein Knoten, und zwar
ein geschlossener Knoten, weil eine Scheidewand da ist,
worauf hier die innern Theile der Blüte stehen.
Der Blütenboden wächst vor dem Blütenstiel aus, und
zwar so, dass Bündel von Spiralgefässen anwachsen, die,
wie gewöhnlich, in der Gestalt der halsbandförmigen Gefässe
sich auswärts wenden. Die Zahl der Bündel kommt
oft mit der Zahl der Blätter in der äussersten Blütenhülle
überein, und die Bündel, welche zu den innern Theilen
der Blüte gehen, wachsen später an; zuweilen sind aber
mehr Gefässbündel als Blätter in der äussersten Blütendecke.
Dieses findet z. B. an Primula sinensis, jenes an
Syringa vulgaris Statt. Aus dem Blütenboden steigen die
Gefässe in den Blütenstiel herab und neue wachsen an,
auf dieselbe Weise, wie sie aus der Knospe in den Ast
herabsteigen (s. §. 64.).
Die meisten Blüten bestehen aus einem Knoten. Es
giebt aber nicht wenige, die zwei Knoten haben, einen untern
für den Fruchtknoten, und einen obern, darauf die
übrigen Blütentheile stehen. Blüten der letzten Art heissen:
ü b e r s t ä n d i g e , der ersten: unterständige. Viele Botaniker
sagen von der überständigen Blüte, der Kelch sei
mit dem Fruchtknoten verwachsen. Aber es ist der ganze
äussere Theil des Blütenbodens oder des Blattstiels, der
sich ausdehnt und eine Hölung bildet, worin der Fruchtknoten
sich befindet; es ist gewiss kein Kelch daran gewachsen,
denn man sieht in einem Querschnitte des unterständigen
Fruchtknotens keine andern Theile, als in dem
Querschnitte eines überständigen Fruchtknotens, wie sich
aus der Vergleichung des Querschnitts der Fruchtknoten
von Ornithogalum umbellatum und Iris acuta ergiebt. Die
h a l b ü b e r s t ä n d i g e n Blüten beweisen dieses ebenfalls.
•• • • :».-