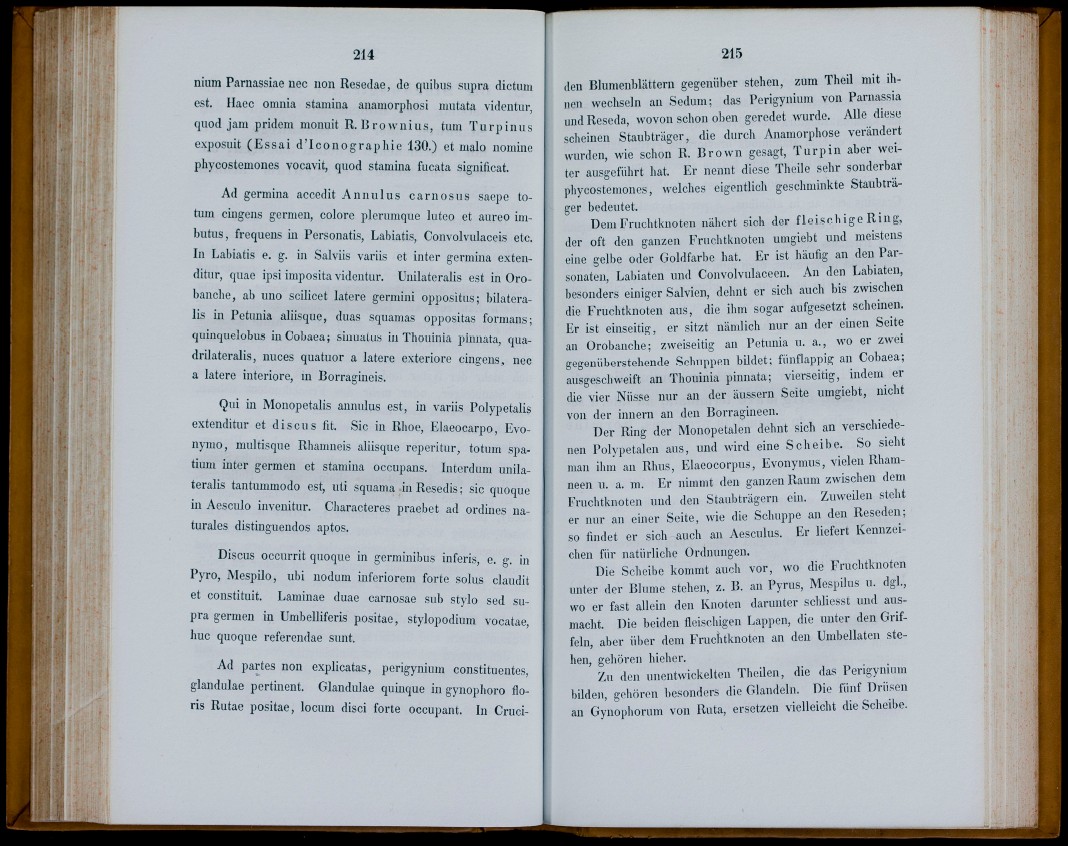
214
nium Parnassiae iiec non Resedae, de quibus supra dictum
est. Haec omnia stamina anamorphosi nmtata videntur,
quod jam pridem monuit R. B r own i u s , tum Turpinus
exposuit (Essai d'Iconographi e 130.) et malo nomine
phycostemones vocavit, quod stamina fucata significai
Ad germina accedit Annulus carnosns saepe totum
cingens germen, colore plerumque luteo et aureo imbutus,
frequens in Personatis, Labiatis, Convolvulaceis etc.
In Labiatis e. g. in Salviis variis et inter germina extenditur,
quae ipsi imposita videntur. Unilateralis est in Orobanche,
ab uno scilicet latere germini opposìtus; bilateralis
in Petunia aliisque, duas squamas oppositas formans;
quinquelobus inCobaea; sinuatus in Thouinia pinnata, quadrilateralis,
nuces quatuor a latere exteriore cingens, nee
a latere interiore, m Borragineis.
Qui in Monopetalis annulus est, in variis Polypetalis
extenditur et discus fit. Sic in Rhoe, Elaeocarpo, Evonymo,
multisque Rhamneis aliisque reperitur, totum spatium
inter germen et stamina occupans. Interdum unilateralis
tantummodo est, uti squama in Resedis ; sic quoque
in Aesculo invenitur. Characteres praebet ad ordines naturales
distinguendos aptos.
Discus occurrit quoque in germinibus inferís, e. g. in
Pyro, Mespilo, ubi nodum inferiorem forte solus claudit
et constituit. Laminae duae carnosae sub stylo sed supra
germen in Umbelliferis positae, stylopodium vocatae,
hue quoque referendae sunt.
Ad partes non explicatas, perigynium constituentes,
glandulae pertinent. Glandulae quinqué in gynophoro fion
s Rutae positae, locum disci forte occupant. In Cruci-
215
den Blumenblättern gegenüber stehen, zum Theil mit ihnen
wechseln an Sedum; das Perigynium von Parnassia
und Reseda, wovon schon oben geredet wurde. Alle diese
scheinen Staubträger, die durch Anamorphose verändert
wurden, wie schon R. Brown gesagt, Turpi n aber weiter
ausgeführt hat. Er nennt diese Theile sehr sonderbar
phycostemones, welches eigentlich geschminkte Staubträger
bedeutet.
Dem Fruchtknoten nähert sich der fleischige Ring,
der oft den ganzen Fruchtknoten umgiebt und meistens
eine gelbe oder Goldfarbe hat. Er ist häufig an denParsonaten,
Labiaten und Convolvulaceen. An den Labiaten,
besonders einiger Salvien, dehnt er sich auch bis zwischen
die Fruchtknoten aus, die ihm sogar aufgesetzt scheinen.
Er ist einseitig, er sitzt nämlich nur an der einen Seite
an Orobanche; zweiseitig an Petunia u. a., wo er zwei
gegenüberstehende Schuppen bildet; fünflappig an Cobaea;
ausgeschweift an Thouinia pinnata; vierseitig, indem^ er
die vier Nüsse nur an der äussern Seite umgiebt, nicht
von der innern an den Borragineen.
Der Ring der Monopetalen dehnt sich an verschiedenen
Polypetalen aus, und wird eine Scheibe. So sieht
man ihm an Rhus, Elaeocorpus, Evonymus, vielen Rhamneen
u. a. m. Er nimmt den ganzen Raum zwischen dem
Fruchtknoten und den Staubträgern ein. Zuweilen steht
er nur an einer Seite, wie die Schuppe an den Reseden;
so findet er sich auch an Aesculus. Er liefert Kennzeichen
für natürliche Ordnungen.
Die Scheibe kommt auch vor, wo die Fruchtknoten
unter der Blume stehen, z. B. an Pyrus, Mespilus u. dgl.,
wo er fast allein den Knoten darunter schliesst xmd ausmacht.
Die beiden fleischigen Lappen, die unter den Griffeln,
aber über dem Fruchtknoten an den Umbellaten stehen,
gehören hieher.
Zu den unentwickelten TheUen, die das Perigynium
bilden, gehören besonders die Glandeln. Die fünf Drüsen
an Gynophorum von Ruta, ersetzen vielleicht die Scheibe.